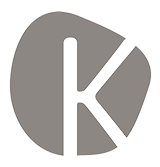Ökonomie
Wir leben in einer aristokratischen Gesellschaft. Man bemerkt es nicht auf den ersten Blick, sondern muss sich die Augen reiben, zum Beispiel an einem Freitag Abend nach einer sehr anstrengenden Woche. Dann kann man sehen, dass es trotz aller demokratischen Gleichheitsideen immer noch, oder schon wieder, die Unterscheidung der Menschen in Herren und Knechte gibt.
Die Herren haben es nicht nötig zu arbeiten, bestenfalls müssen sie an irgendwelchen Schreibtischen Geschäftigkeit mit bürokratischem Firlefanz simulieren, die Herren erhalten arbeitslose Einkommen als „Transferleistungen“ oder lassen ihr Geld für sich arbeiten.
Und die Knechte müssen produktiv sein, müssen den gesellschaftlichen Reichtum, der immer und überall an menschliche Arbeit gebunden ist, herstellen.
Die Arbeit wird von den Knechten verrichtet, die Früchte der Arbeit werden von den Herren genossen. Die einen sind abgeschafft, die anderen grinsen frisch aus der manchmal feinen, bisweilen auch schäbigen Wäsche.
Ökonomie, praktische Philosophie
Es entsteht besonders durch das Meistern von Problemen. Im Überwinden von Widerständen finden die Menschen Genugtuung. Dabei üben und steigern sie ihre Kräfte und sind nachher noch Größerem gewachsen. Im Gesellschaftlichen, aus dem sich die Menschen weder lösen können, noch dürfen, ist das eigene Glück nicht direkt, sondern durch das Glück der Anderen zu erlangen, eine intentio obliqua.
So ist auch der pekuniäre Gewinn, nach dem unser Handeln strebt, nicht so gut direkt zu erzielen, wie durch das Bestreben, die Mitmenschen glücklich zu machen. Wer unglaublich gute Waren und Dienste offeriert, muss sich um sein Auskommen nicht sorgen.
Leben, Ökonomie, praktische Philosophie
Der Staat und die Gesellschaft fahren gegen die Wand. Bedingt ist der Crashkurs durch
- die viel zu niedrige Geburtenrate der einheimischen Bevölkerung und
- die noch viel niedrigere Geburtenrate der leistungsfähigen und intelligenten Frauen. Diese Frauen werden in der Arbeitswelt ausgebeutet, anstatt Kinder zu bekommen und aufzuziehen.
Die Frankfurter Allgemeine Zeitung hat eine zehnteilige Folge dazu geschrieben.
Erziehung, Leben, Ökonomie
Jede Anstrengung, beim Lernen, in der Arbeit, während sportlicher Übungen, droht dann zu scheitern, wenn sich ein Widerstand zeigt. Die Überwindung würde Kraft fordern, die nicht vorhanden ist, oder die nicht investiert werden soll.
Faule Arbeiter machen ihre Sache solange es einfach läuft. Zeigen sich Schwierigkeiten, geben sie auf, führen die Sache nicht zu Ende. Sie erklären, dass es nicht geht. Eigentlich fehlt ihnen nur die Lust, sich anzustrengen, Probleme zu lösen, statt an Problemen zu scheitern.
Ökonomie, Wissenschaft
Ein alter Physiklehrer an der Universität Würzburg erzählte in einer einführenden Veranstaltung über Fehlerrechnung die Geschichte mit den Namen. Wenn in der Wissenschaft etwas mit einem Namen bezeichnet wird, wäre es verdächtig. Wenn dazu noch andere konkurrierende Theorien oder Hypothesen mit anderen Namen von Personen bezeichnet werden, ist an der Sache etwas noch nicht hinreichend geklärt.
Eine gut gesicherte Standardtheorie benötigt keine Namen von Forschern zu ihrer Bezeichnung.
In der Marktwirtschaft ist das anders. Hier betont jeder seine Einzigartigkeit, um sich von der Konkurrenz abzuheben. Die Marke wird wichtig und die Unterschiede werden betont, auch wenn sie der Sache nach gar nicht so groß sind oder überhaupt nicht bestehen. Hier findet eine Fehlinformation der potenziellen Kunden statt, um den Verkauf zu fördern. Das gilt von Waschmitteln bis hin zu Unternehmensberatern, von Fluglinien bis zur Babynahrung.
Ökonomie, praktische Philosophie
Neuerungen sind teilweise höchst nützlich. Nichts gegen diese. Aber Manches wird nur verändert, um den Absatz zu fördern. Der gefräßige Molloch des Kapitals braucht frisches Fleisch, benötigt Moden und Wechsel.
Diese Form der Innovation ist kulturfeindlich, weil sie das Tradierte über den Haufen wirft, nicht weil es schlechter wäre, sondern weil es den Verkauf neuer Produkte behindert.