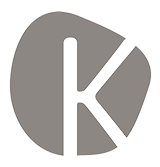Leben, Ökonomie
Um ein bestimmtes, erstrebtes Bild vor sich selbst und anderen zu erzeugen, wird manches erworben. Haus, Auto, Jacht, Jagd …
Der Konsum hat hier Zeichencharakter, er ist semiotisch. Es geht nicht allein um den Gebrauch der Sachen, auch wenn deren Hinweischarakter auf die gewünschten Merkmale wie Erfolg, Reichtum, Modernität, Tradition usw. hinterfragt, in Abrede gestellt würde.
Ökonomie, recht
Korruption ist teuer. So wird nicht das Angebot genommen, das von der Sache her am besten ist, sondern ein Anbieter bekommt den Zuschlag, der eine schlechtere Leistung durch Bestechung kompensiert.
Das Gleiche gilt für Ämterpatronage. Hier wird ein schlechter qualifizierter Bewerber den Besseren vorgezogen, weil er mehr „Vitamin B“ hat.
Den Nachteil bei Korruption, Nepotismus usw. haben vor allem die, die für eine schlechtere Leistung mehr zahlen. Für den Steuerzahler ist das besonders ärgerlich. Er wird über die Verwendung der Steuergelder kaum informiert und seine Möglichkeiten Korruption, Parteienklüngel und Ämterpatronage aufzudecken, sind gering. Wenn einmal etwas an die Öffenlichkeit gerät, sind die Möglichkeiten der Bestrafung schwach und unsicher.
Ökonomie
Verluste gibt es in der gegenwärtigen Weltwirtschaftskrise zuhauf.
Aber geht das Geld wirklich verloren, oder gehen materielle Reichtümer verloren, so wie man einen Schlüssel oder einen Handschuh verliert?
Wohl kaum, denn es wurde weder materieller Reichtum wie in einem Krieg oder in einer Naturkatastrophe vernichtet, noch wurde Papiergeld verbrannt, noch wurden Kontenstände einfach gelöscht.
Ich fürchte vielmehr es fand und findet eine Umverteilung in gigantischem Massstab statt. Und die Gewinner dieser Umverteilung bleiben anonym. Die Verlierer sind die meisten Menschen. Anlass dieser Umverteilung sind m. E. die hohen Kriegskosten der USA.
Ökonomie
Wenn Gewinne erzielt werden, muss alles möglichst privatwirtschaftlich sein. Der Staat soll sich raus halten und als „Nachtwächter“ höchstens den ordnungspolitischen Rahmen abstecken.
Geht’s schief, kommt eine Depression, drohen Pleiten, dann soll der Staat einspringen, der Steuerzahler soll Geld geben, der Staat Eigentümer bei Unternehmen werden, die ohne seine Hilfe nicht weiterbestehen könnten.
Ist das richtig? Gelten die Prinzipien der Marktwirtschaft nur bei schönem Wetter, bei Sonnenschein, und muss der Staat einspringen, wenn es stürmisch wird?
Und wer ist der Staat? Wer sind die nationalen Notenbanken? Wem gehören beispielsweise die us-amerikanische oder die britische Nationalbank, das „Federal Reserve System“ und die „Bank of England“? Sind das nicht private Banken, die sich hinter einem staatlichen Mantel verstecken? Und wenn der Staat, beispielsweise in Deutschland, finanziert, macht er das auf Pump. Und von wem bitte leiht er sich da Geld, von welchen Banken? Hier bekommt der Souverän, das Volk, merkwürdiger weise kaum eine Auskunft. Komisch!
Ökonomie
Über die gegenwärtige Weltwirtschaftskrise wird nicht mehr geschwiegen, sie kann nicht mehr unter den Teppich gekehrt werden. Das war zu Beginn der Krise im Sommer 2007 noch möglich. Damals war alles noch weit weg und auf schlechte Baufinanzierungen in den USA begrenzt.
Nur, wenn alle großen Investmentbanken der Wall Street auf die eine oder andere Art verschwinden, wenn auch deutsche Banken vor der Pleite durch Staatseingriffe bewahrt werden, wenn die Automobilindustrie der USA kurz vor der Insolvenz steht, dann kann man nicht pfeifen und so tun, als sei nichts Besonderes geschehen.
Fragen, die die ganze Bevölkerung unseres Landes angehen, müssen gestellt, diskutiert und beantwortet werden. Kreative Lösungsmöglichkeiten müssen besprochen und begangen werden. Und die Verantwortlichen müssen streng zur Rechenschaft gezogen werden. Das alles zügig und professionell.
Ökonomie, praktische Philosophie
Die weltweite Finanz- und Wirtschaftskrise hat die moralische Diskussion über das wirtschaftliche Handeln verstärkt. Von Gier als Laster, von Maßlosigkeit, von Egoismus wird gesprochen.
Traditionelle Werte führt man dagegen an: Bescheidenheit, Sparsamkeit, Redlichkeit.
Mir scheint das richtig. Zwei Probleme sehe ich jedoch:
Einmal wird jeder Gauner, je besser und größer er ist, desto mehr, sich als Ehrenmann allerhöchster Güte darstellen. Ja die Gaunerei funktioniert um so besser, je geschickter sich der Gauner als Tugendausbund zu tarnen versteht und dadurch das Vertrauen seiner Mitmenschen und Opfer zunächst gewinnen und daraufhin missbrauchen kann. Räuber und Diebe in Nadelstreifen.
Die zweite Aporie sind außer- und übermoralische Systemzwänge: Würde ein Wirtschaftsteilnehmer sich herausragend moralisch verhalten, liefe er Gefahr auszuscheiden, den Konkurrenzkampf zu verlieren. Bei Angestellten ist das genauso. Beispielsweise verzichtet ein Unternehmen bei der Auftragsaquise auf Korruption. Es bleibt anständig aber auch ohne Aufträge und scheidet bald aus dem Wirtschaftsleben aus. Oder ein Angestellter wehrt sich gegen unlautere Machenschaften und arbeitet redlich. Er wird zunächst nicht befördert, dann entlassen.
Was kann man daraus schließen? Moral braucht eine sehr breite Front. Moral braucht eine starke Öffentlichkeit und Transparenz. Dunkle Machenschaften müssen ans Licht. Und Moral braucht die Angst vor Strafe bei Zuwiederhandlung und eine harte und gerechte Strafverfolgung. Das Risiko für unmoralisches Verhalten muss deutlich größer sein, als das Risko moralischen Handelns.