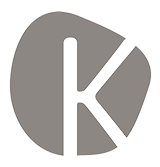Evolution, praktische Philosophie
Als „Vertikalspannung“ bezeichnet Peter Sloterdijk die Rangunterschiede zwischen Menschen. Diese werden durch Übung, durch Training vergrößert oder auch verringert, jedenfalls führt Training nach oben und der Gemeinplatz sagt, Übung macht den Meister.
In seiner Abhandlung „Du mußt dein Leben ändern – Über Anthropotechnik„ lässt Sloterdijk jedoch Wesentliches außer Acht. Einmal ist nicht alles eine Sache des Trainings, das Erbe, ob genetisch, kulturell und allgemein die vorgefundenen Bedingungen sind durch Training wenig zu beeinflussen.
Eine weitere Auslassung ist das Training in sozialen Bezügen. Sloterdijk referenziert Übung in seinem Buch auf den Einzelnen. Interessanter ist aber die Übung als soziale Interaktion. Das beginnt mit der Familie, in der Kindergartengruppe, in der Schule, in der Sprachgemeinschaft, in der religiösen Gemeinde, im Sportverein bis hin zum Internet als virtueller Weltgemeinde.
Eine Aporie, die erwähnt werden müsste, ist die Blindheit der Evolution, gemäß der herrschenden Theorie. Man kann zwar mit Nietzsche behaupten, dass die Schwachen, Kranken, die Zukurzgekommenen, die minderwertigen Herdenmenschen und ihre Führer sich durchgesetzt haben. Aber nach dem Prinzip der Selektion sind dann auch die Schwachen, wenn sie sich durchgesetzt, erhalten und vermehrt haben, die Starken. Und vermeindlich starke Menschen, die in der Selektion untergehen, sind nach diesem Kriterium eben nicht stark, sondern schwach.
praktische Philosophie
Es ist letztlich doch erschreckend, wie aufgeregt mancher in bestimmten Situationen reagiert. Wie nervös, mit zittrig erregter Stimme sich einer in öffentliche Gespräche einlässt, wie unsicher und deprimiert ein anderer nach juristischen Angriffen anmutet, selbst wenn an der Sache nicht das geringste dran ist.
Die Erregtheit, die Nervosität, das Laute und das hohe Energieniveau der Aufgeregtheit sind schädlich für den Akteur und das unbeteiligte Publikum. Nützlich ist die gesteigerte Erregtheit lediglich für die Gegner, denn sie gewinnen an relativer Stärke.
Ruhe, Gelassenheit und Kaltblütigkeit stehen dem entgegen. Eine stoische Haltung und Augenmass, das die Angelegenheit in ihren wirklichen jeweiligen Größenverhältnissen und nicht aufgebläht erscheinen lässt, sind ein Antidot.
Die Grundlage echter Gelassenheit bis hin zur Gleichgültigkeit ist eine transzendente Versicherung über alle Endlichkeiten hinaus. Das kann geübt werden und betrifft nicht nur die geistigen Vollzüge, sondern den ganzen Körper und nicht nur das, sondern diese Rückbindung (= religio) schließt die Gemeinschaften, die kulturellen und natürlichen Umgebungen mit ein.
Eine Probe für wirkliche Religion ist somit die transzendent gegründete, unerschütterliche Gelassenheit.
praktische Philosophie
Wenn sich eine Situation zuspitz, schwieriger wird, müssen Entscheidungen getroffen werden. Die Durchsetzung der Entscheidungen fordert und übt die Kräfte. Das Ergebnis kann, muss aber nicht eine Verbesserung sein.
Das ist der Sinn von Krisen und die Wortherkunft, κρίσις, entspricht der Entscheidung.
So kann Leid in der Tat nicht nur eine Prüfung unserer Kräfte bedeuten, sondern auch eine Stärkung, indem wir uns anstrengen müssen, aus dem gewohnten Trott herausgehoben werden und dadurch vielleicht grundlegen zum Besseren gelangen.
praktische Philosophie
Im konservativen Denken ist es durchaus üblich, sich auf das Irrationale, das Außerrationale, das Nichtbegründbare zu berufen. Nur ist es oft auch sinnvoll die Rationalität so weit zu treiben, wie sie trägt und dann das Außerrationale zu konstatieren. Die rationale Gestaltung des Außerrationalen ist sehr kurz gefasst, es ist das „trans“ und fertig. Es darf nicht zur Bequemlichkeit werden, die Nachdenken erspart.
praktische Philosophie
Kant reiste nie und blieb zeitlebens in Königsberg. Hegel stellte sich schrecklich an und wollte ebenso nicht verreisen. Selbst Goethe, der umfangreichere Reisen unternahm, kehrte nach einem Kutschenunfall während seines letzten Reiseversuchs um und fuhr wieder nach Hause. Heidegger reiste wenig und besuchte erst spät Griechenland, auf das er sich philosophisch oft bezog. Und Nicolás Gómez Dávila blieb sein Leben lang, Jugendjahre in Paris ausgenommen, in Bogota.
Reisen mag bilden, aber offenbar nicht philosophisch. Die denkenden Autisten interessieren sich nicht für die vorüberziehenden Landschaften, die wechselnden Eindrücke von Menschen und Lebensverhältnissen. Sie lockt nicht die erotische Aussicht im Fremden. Der Überfluss an Mannigfaltigkeit im sinnlich Konkreten ist ihnen eher langweilig und sie werden statt dessen angezogen von den Höhen der Abstraktion.
praktische Philosophie
Die Klage, so lautet ein Topos, über schlechte Manieren ist ein Teil derselben. Und auch die Bemühung um Stil und Umgangsformen zeigt einen Mangel.
Zudem ist Ehrgeiz verbreitet und ein Schielen nach höherem Rang und dessen Zeichen.
Wie wäre es dagegen sich eine Rangstufe nach unten zu orientieren, sozusagen als Gegengift für falsches Prestigestreben.
Noch besser wäre die sichere Einnahme des wirklichen Ranges mit allen Zeichen und Selbstverständlichkeiten. In einer durch den Wechsel der Moden bewegten Zivilisation ist allerdings die Sicherheit verloren gegangen, den rechten Platz in der Gemeinschaft zu treffen.
Und die Verschleierung der wirklichen Herrschaft durch eine Gleichheitsideologie macht das Denken und Handeln in Rangordnungen unpopulär.
Doch auch hier zerbrechen an der Wirklichkeit Ideologien und die Lüge von der Gleichheit entlarvt sich durch die Gleicheren unter den Gleichen.
Natürlich unter den Menschen sind unterschiedliche Ränge an Kraft, Schönheit, Weisheit, gesellschaftlicher Stellung, Autorität …