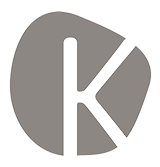Leben, praktische Philosophie, Religion
Der Begriff stammt aus der Ethik Albert Schweitzers. Nicht, dass ich die Auffassungen dieses großen Mannes übernehmen würde. Sein Projekt in Lambaréné scheiterte auf längere Sicht, vermutlich auch aufgrund von Mängeln in seiner moralischen Konzeption.
Aber „biopositiv“ ist eine nützliche Bezeichnung für all das, was das Leben der Menschen über Generationen hinweg erhält, fördert und vermehrt.
Die katholische Ethik, man mag über die Dogmatik denken was man will, die Ethik ist lebenserhaltend und -fördernd. Und sie ist es heute in einem Maß, das sonst nicht mehr zu finden ist.
Die katholische Moral lenkt die Sexualität hin zur Liebe in der Ehe und hin zur Fortpflanzung. Sie ist für unbedingte Treue, für Keuschheit, gegen Homosexualität, gegen Pornographie und Prostitution, sie schützt das ungeborene Leben, sie ist gegen Empfängnisverhütung, gegen Geburtenkontrolle und fördert Familien.
Die katholische Ethik ordnet das Miteinander der Menschen, lehrt Vergebung und Nächstenliebe bis hin zur Feindesliebe. Sie richtet sich mutig gegen die Zerstörung der Menschen, gegen Schäden am Gemeinwesen.
praktische Philosophie
Wilfried Fritz Pareto, oder italienisch, Vilfredo Pareto, interpretierte die Geschichte der Menschen als Wechsel der herrschenden Eliten, als Fiedhof der führenden Gruppen.
Möchte man wirklich die Besten, die eigentliche Aristokratie, an der Spitze einer Gesellschaft wissen, so darf diese Elite nicht selbst ernannt sein und die Macht usurpieren, sondern sie muss sich bei Wahlen anderen konkurrierenden Eliten stellen. Und auch nach den Wahlen darf der Wettbewerb um die besten Lösungen nicht enden, vielmehr muss er fair und frei ausgetragen werden können. Das zeigt, dass wirkliche Demokratie eine notwendige, wenn auch nicht hinreichende Bedingung dafür ist, dass die Besten herrschen und zwar kontrolliert, auf Zeit und der freien Konkurrenz ausgesetzt.
Wer dagegen, wie in einer Diktatur, die Opposition ausschaltet, zeigt Schwäche, traut sich nicht zu, im fairen Kampf zu siegen.
praktische Philosophie
Das Rasieren, das Scheren war früher Zeichen der „Häuslinge“, die ihr Leben in Abhängigkeit auf einem Bauernhof verbringen mussten und nicht heiraten durften.
Bei mir selbst erzeugt die Rasur ein Wundsein der Haut. Auch der Haarschnitt führt meist zu einer leichten Erkältung, woran man sieht, dass Haare schützen, nicht nur vor Kälte, auch vor Hitze, man bedenke die Gefahr starker Sonneneinstrahlung für einen Glatzkopf. Haare schützen auch vor Wind, Feuchtigkeit und kleinen Verletzungen.
Also, warum sollte man wie ein Gescherter herumlaufen? Der frei Mann trug zumindest früher langes Haar und einen Bart.
Und nicht zuletzt haben wir im christlich geprägten Abendland ein Bild des Erlösers, das selten ohne Bart und langes Haupthaar ist.
Erziehung, praktische Philosophie
Die ländliche Idylle stirbt an bösartigen Geschwüren, die sich vor allem an ihren Rändern zeigen. Sie zersetzen die gewachsene natürliche, landwirtschaftliche und architektonische Schönheit durch ihr invasives, destruierendes und metastasierendes Wachstum.
Dabei hätte das Dorf, der Einsiedlerhof und die Kleinstadt weit ab von Metropolen Vorbilder genug im Natürlichen in Verbindung von dem durch Menschenhand über Jahrhunderte in strenger Tradition und regionaler Färbung Geschaffenen. Aber diese vorliegende Schönheit wird nicht erfasst, die Gegebenheiten in ihrer ästhetischen Stimmigkeit nicht erkannt. Das verwundert den Betrachter zunächst.
Dennoch führt das alltägliche Sehen, der selbstverständliche Umgang mit schönen Dingen nicht notwendig zu deren Verständnis. Die Empfindung des Angenehmen erfordert Schulung und Muße. Der stumpfe, abgearbeitete Blick kann es kaum erfassen. Besser wird es durch stundenlangen Konsum der Fernsehprogramme nicht.
So findet sich auch in der Geschichte von Philosophie und Wissenschaft eine lange Tradition der Skepsis, eine Kritik des Ungenügens bloßer sinnlicher Eindrücke ohne das daran geknüpfte Denken und Empfinden.
φύσις κρύπτεσθαι φιλεῖ. (Heraklit 123)
Die Natur, hier des Schönen, liebt es sich zu verbergen. Sie zu entbergen erfordert Kraft, Erziehung und Talent.
Das wird nur von wenigen geleistet werden können. Diese brauchen das Recht, die Einsichtslosen zu leiten. Die Führung durch eine Elite der Architektur, Landschafts- und Siedlungsgestaltung wäre nötig. Gewinnen durch die strenge, traditionsgebundene Leitung einiger würden alle.
praktische Philosophie
Der im Wettbewerb Siegreiche hat die Anerkennung der Zuschauer, vielleicht aber auch den Neid der Mitkombattanten.
Lediglich den erschlichenen Sieg missgönnt auch das Publikum.
So ist es mit anderen Arten der Vorzüglichkeit, des hohen Ranges. Die Unbeteiligten anerkennen und schätzen ihn, wenn er rechtmäßig erlangt wird. Sie missbilligen legitimerweise den vorgespielten, den angemaßten, den unverdienten, erschlichenen, auch den ererbten und nicht aus eigener Kraft erworbenen Rang.
So hat die Masse ein gutes Gespür für echte Führung, sie anerkennt, ja sie bewundert und liebt diese bisweilen sogar.
Dagegen wehrt sie sich gegen das Angemaßte, das Erschleichen von Privilegien durch Machtpositionen, das Getue einer Pseudoelite, die sich im Rampenlicht gefällt ohne wirkliche Leistungen zu vollbringen. Allerdings stumpft die Mehrheit gegen diese Usurpatoren einer hohen Position allmählich ab, zu häufig ist das Phänomen.
Aber darin liegt auch die Möglichkeit wirklicher Vorzüglichkeit, die wie aus dem Nichts erscheinen kann und den Menschen wie eine Erleuchtung begegnet, wie etwas lange Vermisstes und beinahe unbewusst ersehntes. Das Messianische der wirklichen Vorzüge, des echten Ranges überzeugt unmittelbar.
Nur gegen Mitbewerber und deren Neid muss sich wahre Vorzüglichkeit in Acht nehmen, sonst landet sie „am Kreuz“. Aber selbst nach dem Kreuz kommt Ostern und die Hoffnung ist nicht verloren.
praktische Philosophie
In unserer Gymnasialzeit verwandten wir für den Aufsatz die folgenden Elemente:
• die Stoffsammlung,
• die Gliederung,
• den Entwurf und
• die Reinschrift mit
• der abschließenden Korrektur.
Das war sehr gut und weit besser als das bloße Drauflosschreiben, dem ich heute gelegentlich unter Zeitdruck nachgehe.
Schade, dass die Kunst des Aufsatzes, anders als in Frankreich, bei uns nicht gepflegt wird. Politiker und andere Eliten könnten zeigen, ob sie lediglich Sprachrohre sind, oder ob sie unter Prüfungsbedingungen selbst etwas zu sagen wüssten und dieses auch formal gut ausdrücken könnten.
Frankreich pflegt eine Kultur seiner Sprache von der Deutschland für sich profitieren könnte. Der soziale Rang wird dort nicht so sehr über Vermögen, Kleidung, gesellschaftliche Kontakte als über das sprachliche Niveau bestimmt. Auch England differenziert die sozialen Klassen über die Sprachkompetenz.