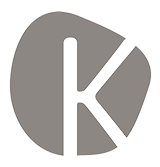Erziehung, Ökonomie, praktische Philosophie
Leicht sieht es aus, wenn einer seine Sache beherrscht. Fast so, dass man versucht wäre zu meinen, man könne das auch. Es sieht wirklich einfach aus, mühelos, selbstverständlich, routiniert, spielerisch und so, als mache es Spaß.
Dementgegen wirkt die Beteuerung, das was man mache, sei höchst schwierig, äußerst kompliziert und erfordere höchstes Können, ganz und gar plump, ja es entsteht der Verdacht, man habe es nicht mit einem wirklichen Könner zu tun. Der, der die Schwierigkeiten seiner Arbeit so hervorkehrt, setzt sich dem Misstrauen aus, und ihm wird, bisweilen zu Recht, unterstellt, er beherrsche das Ding doch nicht so richtig. Vielleicht will er auch nur den Preis der Angelgenheit in die Höhe treiben, wenn er beständig versichert, wie schwierig, wie komplex und zeitaufwendig das alles ist.
Nietzsche ist in diesem Sinn der Philosoph der Leichtigkeit, der Kraft, des Lachens und des Tanzes. Der Wille zur Macht lässt das Schwere, das Schwache, das Müde und Bemühte hinter und unter sich.
praktische Philosophie
Über die Götter oder das Göttliche oder über Gott könne nichts Bestimmtes ausgesagt werden.
Seit der griechischen Philosophie wird dieser Vorbehalt geäußert. Auch im Christentum, besonders in der christlichen Mystik, gibt es eine negative Theologie.
Wie weit ist negative Theologie jedoch Agnostik? Streng genommen müsste man ja, sofern man vom Göttlichen nichts sagen kann und darf, auch darüber in Unkenntnis sein, dass es das „Göttliche“ oder ein „Gott“ ist, über den man nichts weiß und sagen kann.
Hier hat der Agnostizismus ein Einfallstor zur Theologie, und umgekehrt hat die Theologie über die negative Theologie eine Möglichkeit in den Agnostizismus zu entweichen.
Erziehung, Ökonomie, praktische Philosophie
Wie beim Hundermeterlauf, so gibt es bei jedem Wettkampf und Wettbewerb zwei Methoden um besser zu sein als die anderen.
Einmal gibt es den fairen Weg durch hervorragende eigene Leistung die anderen zu überbieten.
Andererseits existiert auch der unfaire Weg. Einmal liegt der darin den anderen zu schaden. Des weiteren ist es ebenso unfair durch unlautere Mittel die eigene Leistung zu steigern.
Erziehung, praktische Philosophie
Einfache, regelmäßige Tätigkeiten zeigen oft erstaunliche Resultate.
Vielleicht hat Ernst Jünger auch durch sein morgendliches, kaltes Bad ein so hohes Alter erreicht.
Sport und geistige Fähigkeiten verlangen beständiges, ausdauerndes Üben. Imgleichen ist es bei der Musik.
Große Berge werden mit kleinen Schritten bestiegen. Und wer erst einmal den Anfang geschafft hat, der geht oft ohne Mühe weiter.
praktische Philosophie
Introversion ist weiter verbreitet als es scheint. Das liegt in der Natur der Sache. Introvertierte Menschen treten nicht so sehr nach außen hin auf. Sie bilden keine Netzwerke, ihr „networking“ nähert sich der Nulllinie. Sie gründen keine Gesellschaften, Vereine, sitzen nicht in Talkshows und tummeln sich nicht auf Bällen oder Kongressen.
Sie werden in ihrer Zahl zumindest unterschätzt.
Gelegentlich aber haben sie einen öffentlichen Auftritt.
Eine dieser Epiphanien bildete das Gespräch in einer amerikanischen Talkshow mit dem ehemaligen Vorsitzenden der us-amerikanischen Notenbank(en) Federal Reserve System, Alan Greenspan. In der Charly Rose Show bezeichnete sich Greenspan als extrem introvertierten Menschen. Das ist bemerkenswert, wenn man die öffentliche Position bedenkt, die er 1987 bis 2006 inne hatte.
Noch besser als dieses Geständnis einer starken Introvertiertheit in einer Fernsehtalkshow gefällt mir allerdings die Beschreibung des Protagonisten aus „Die Blendung“ von Elias Canetti. Peter Kien, die Hauptfigur des Romans, bemerkt nicht ein mal, dass ein Passant mit ihm spricht und sich nach dem Ort erkundigt. Kien redet nicht auf Kongressen zu seinem Fachgebiet und scheut jeden Kontakt mit „den Menschen“, bis er dann in weltfremder Art aus praktischen Erwägungen heraus seine Haushälterin ehelicht … Die folgenden sehr menschlichen Verwicklungen sind für den an Introversion als reinem Zustand interessierten nicht mehr lesenswert.
Evolution, Leben, praktische Philosophie, Religion
Je absurder der Inhalt, desto gemeinschaftsstiftender die Wirkung und der mit der Zugehörigkeit zur Gemeinschaft verbundene Selektionsvorteil.
Glaubensbekenntnisse ideologischer oder religiöser Natur haben, so denke ich, nicht vorwiegend den vermeintlichen Inhalt der Aussage zum Gegenstand.
Die Hauptfunktion dürfte vielmehr das Signal der Konformität sein, des Dazugehörens, des Mitmachens, des „ich bin auch dabei, ich gehöre zu euch, wir gehören zusammen“.
Das Bekenntnis ist also vermutlich nicht so sehr auf der rationalen, inhaltlichen Ebene bedeutsam, sondern als Bekenntnis der Gruppenzugehörigkeit.
Evolutionsbiologisch ergibt sich aus der Zugehörigkeit zu einer Menschengruppe ein bedeutender, ja ein über Leben und Tod entscheidender Vorteil. Das ausgeschlossen sein, das nicht mehr Dazugehören, der Ostrazismus, bedeuteten früher den ziemlich sicheren Tod.
Die Menschen haben ein tief verwurzeltes Gespür für die Gefahr in Widerspruch zur eigenen Gruppe zu geraten. Deshalb wird zu vielfachen Anlässen und Gelegenheiten die Zugehörigkeit bekräftigt. Das mag durch Riten, durch den Gestus, durch das äußere Erscheinungsbild geschehen oder durch verbale Äußerungen und (Lippen-)Bekenntnisse.
Der vordergründige Inhalt, beispielsweise die Aussage man glaube an die jungfräuliche Geburt Jesu, ist dabei nicht so sehr wesentlich. Es muss im Grunde genommen gar nicht aufrichtig gemeint sein. Viel wichtiger bei dergleichen Äußerungen ist das Bekenntnis der Zugehörigkeit, der Zusammengehörigkeit.
Selbst Immanuel Kant kroch auf diese Weise mit seiner kleinen Spätschrift zur Religion zu Kreuze.
Die Distanz, der Widerspruch zum herrschenden Glauben, das Nichtdazugehören zur Religions- oder Ideologiegemeinschaft hat vielfältige Nachteile. Der Dissident wird gemieden. Er ist in Gefahr. Im katholischen Polen des 18. Jahrhunderts war er in Gefahr, geköpft zu werden. Und noch davor wurden in ganz Europa Ketzer eifrig verbrannt.
Der Selektionsvorteil des Konformismus liegt somit auf der Hand, auch heute noch. Das Bekenntnis die herrschende Lehre zu glauben, auch, und gerade wenn sie noch so absurd ist, hilft beim Überleben und sich Vermehren in einer Gruppe.
Zu fragen wäre auch in die entgegengesetzte Richtung, ob denn der Dissens, der Widerspruch zur herrschenden Ideologie, die Verweigerung von Bekenntnissen der Dazugehörigkeit, ebenso und auf verschiedene Weise Selektionsvorteile bieten.
Das mag bei der Gruppenselektion dann so sein, wenn der Dissens in einer Gemeinschaft von verschworenen „Ungläubigen“ und „Widerständlern“ gelebt wird. Dann übernimmt der Glaube an den Dissens die Rolle der Gemeinschaftsstiftung. Der enorme und noch stärkere Gruppenzwang von Protest- und Widerstandsgruppen ist auf diese Weise eine alternative Gemeinschaftsstiftung und verhilft so zu einem Selektonsvorteil in der Gruppe, nur eben in einer oppositionellen Gruppe. Wenn dann die Dissidentengruppe auch noch im Laufe der Zeit zur neuen herrschenden Richtung wird, hat man auf das richtige Pferd gesetzt. Der Dissens wird zum Konsens, zum Mainstream. Die Ideologie der Revolutionäre wird zum Glauben der herrschenden Gewalten. Für das Bekenntnis zu dieser Glaubensrichtung gilt das oben gesagte.
Das Bekenntnis der Zugehörigkeit hat um so mehr Wert, je absurder der vorgebliche Inhalt ist. Je irrationaler die Behauptungen der Glaubensbekenntnisse, desto nachdrücklicher wirken sie als Konformitätsaussagen, als Versicherungen darüber, dabei zu sein, mit zu machen, dazu zu gehören. Dieser Wert der Konformitätsaussage ist größer bei absurden, irrationalen Inhalten, die sich empirisch, rational in keinster Weise nachvollziehen lassen. Es ist ein Zeichen dafür, wie viel einem die Zugehörigkeit wert ist, es ist der „Mitgliedsbeitrag“ als teilweiser Verzicht auf Rationalität, als Fürwahrhalten völlig unzureichend bewiesener Aussagen. Hinzu kommt bei der Gruppenzugehörigkeit noch der Beitrag an Geld, Arbeitskraft, Zeit, menschlicher Zuwendung, Lernen und Weitergeben der ideologischen Reden und Erzählungen … Es wird so der handfeste Beweis geliefert wie viel einem die Zugehörigkeit wert ist, welchen Preis, auch an Rationalität, man zu zahlen bereit ist.
Ich habe über diesen religionsphilosophischen Zusammenhang noch nirgendwo gelesen. Tertullians Satz, „Certum est, quia impossibile“, der später als „Credo quia absurdum“ kolportiert wird, nennt den Glauben an das Widersinnige, das Absurde, bezeichnet aber nicht die Funktion der Gemeinschaftstiftung gerade durch widersinnige Glaubenssätze („Certum est, quia impossibile“ – „Es ist gewiss, weil unmöglich“ „Credo quia absurdum“ – „Ich glaube weil es widersinnig ist“). Auch die Abgrenzung gegen andere Gruppen dürfte mit widersinnigen Dogmen besser gelingen. Common sense, das allgemein Akzeptierte und unmittelbar Einsichtige, das überall als bewiesen Geltende, taugt nicht zur Gruppenbildung und Abgrenzung gegen die „Ungläubigen“.