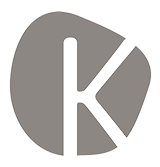praktische Philosophie
Was sind die Grenzen des Wissens? Was wissen wir und was wissen wir nicht?
Die Metapher der Grenze scheint irreführend, denn eine exakte Linie ist nicht auszumachen bis zu der wir alles genau wissen und über die hinaus wir gar nichts mehr erkennen.
Die Übergände sind eher graduell mit Rissen, Sprüngen und mehr oder weniger starken Verläufen und Unschärfen, eher wie eine unsichere Moorlandschaft im Nebel der Morgendämmerung. Und das zudem auch mit zeitlich wechselnd schnellen Änderungen, sodass, wo neulich noch fester Tritt war, bald darauf kein Halt mehr ist und einer rettungslos versinkt.
Evolution, praktische Philosophie
Das Fernsehen, Filme, Unterhaltungsliteratur bauen eine Scheinwelt auf, in die sich das Publikum flüchten kann. Das ist gefährlich, denn diese Scheinwelt verhindert das Verständnis der wirklichen Welt. Die Realitätsflucht erschwert das Bestehen in der Realität.
Fähigkeiten verkümmern, die in einer Fernsehwelt nicht geübt werden. Kinder werden unsportlich, besitzen weniger räumliche Koordination, die Sprachkompetenz nimmt ab und die Fähigkeit zum Zwischenmenschlichen ist schwächer entwickelt.
Kurz, diese Scheinwelten machen dumm, dick, lebensuntüchtig und führen zu weniger Nachkommen. Die Scheinwelten mutieren ihre Opfer zu evolutionären Blindgängern.
Information, Kunst ist dann gut, wenn sie das Verständnis unserer wirklichen Lebenswelt stärkt. Evolutionsbiologisch gesehen, ist die Darstellung von Welt oder von Phantasiewelten dann gut, wenn sie zu Erhalt, Wachstum und Vermehrung führt.
Frank Schirrmacher ist u.a. ein Prophet dieses Themas.
praktische Philosophie
Ein beliebtes Spiel der Schulen in den 70er Jahren war der Systemvergleich zwischen West und Ost. (Ich war in dieser Zeit Gymnasiast in Marktheidenfeld, Bayern.) Auf der einen Seite stand die freie Marktwirtschaft, auf der anderen die zentrale Verwaltungswirtschaft. Je nach politischer Vorliebe der Lehrer fiel das Ergebnis aus. Die Lehrpläne und offiziellen Unterrichtsmaterialien wiesen, vermutlich zurecht, eine deutliche Überlegenheit der freien Marktwirtschaften nach.
Werden eigentlich auch heute noch in den Schulen oder Medien Systemvergleiche angestellt? Wird China mit den USA oder Russland verglichen? Oder wird das marktwirtschaftliche mit dem planwirtschaftlichen Russland verglichen?
Oder vergleicht man lieber erst gar nicht? Und wenn verglichen wird, geschieht das differenziert? Und was kann man daraus lernen?
praktische Philosophie
Es geht um Moral, um Begründung von Moral, also Ethik.
Wenn etwas unmittelbar angenehm ist, sind moralische Regeln nicht nötig.
Erst wenn die nahe liegende Handlung unangenehm ist, oder schwierig, mühsam, schmerzhaft, anstrengend usw., dann wird eine moralische Regel erforderlich. Diese Regel bewirkt im Allgemeinen, dass die unangenehme Handlung in Kauf genommen wird für ein höheres Gut, das mit ihr verbunden ist. Eine Unangenehme Handlung alleine für sich, ohne ein daraus folgendes Gut, ist moralisch nicht erstrebenswert. So ist auch „Leiden“ oder ein „Opfer“ ohne ein daraus erwachsendes höheres Gut sinnlos und verwerflich.
Es wird allerdings, durchaus und insbesondere in religiösen Systemen, ein „Opfer“ ohne Rücksicht auf ein höherwertiges Gut gefordert. Das ist vor allem dann hinterhältig, wenn die eigentlichen Profiteure der pseudomoralischen Handlung nicht genannt werden möchten. So wird man Opfer oder Leiden an sich für gut erklären, ohne das dadurch bewirkte Gut zu bedenken, wenn eine Pristerkaste oder irgendeine andere herrschende Gruppe davon profitieren, aber als Profiteure nicht klar erkannt werden wollen, meist aus Furcht vor berechtigter Rebellion.
Die moralische Handlung ist, ökonomisch formuliert, der Preis für den moralischen Gewinn.
Das Gut ist weiter weg als die moralische Tat. Diese Entfernung kann zeitlich sein. Zunächst muss man als Schüler fleißig lernen, dann bekommt man gute Noten, einen guten Abschluss und den gewünschten Beruf. Der zeitliche Horizont in diesem Beispiel erstreckt sich über viele Jahre.
Die Entfernung kann auch ein Nutzen für andere Menschen sein, die einem nicht so nahe sind, wie man selbst oder der engere Kreis der Familie, der Kollegen usw.. Z. B. verzichtet man auf das Ausgeben einer Summe und spendet das Geld für notleidende Menschen in einem fremden Land.
Man sieht, das Gut ist weiter weg, ist entfernter, als die moralische Handlung. Die Unannehmlichkeit ist näher, als der Gewinn. Das macht moralische Regeln überhaupt erst nötig und das macht die Befolgung moralischer Regeln auch häufig schwierig und führt letztlich nicht selten zur Missachtung der Regel, der unangenehmen Pflicht.
Wenn Last und Nutzen bei derselben Person liegen, ist die Sache einfacher. Die Ernte wird lediglich später eingefahren.
Komplexer ist es, wenn die Mühen bei dem Einen liegen, der Gewinn aber bei einem Anderen. Der, der die Beschwerlichkeiten hat, fährt nicht die Ernte ein. In der Erwerbswelt sieht es dann so aus, dass der eine die Arbeit hat und der andere den Ertrag der Arbeit genießt. Das ist der Fall schon bei einer schlichten Geldspende. Der Geber muss in der Regel für das Geld arbeiten, der Empfänger hat den Nutzen, den Ertrag der Arbeit. Wenn man jemandem selbst verdientes Geld schenkt oder spendet, arbeitet man mittelbar für ihn.
Die Frage in solchen Fällen ist, wem nützt diese moralische Regel? Cui bono?
Evolutionsbiologisch ist Moral, die nicht direkt die eigenen Gene fördert, von fraglichem Wert. Hier ist es aber auch entscheidend, wie die Einheit bestimmt wird, die einer Selektion unterliegt. Sind es nur Individuen und deren Erbgut (Gene), so ist altruistisches Verhalten gegen nicht verwandte Menschen schwer zu erklären. Sind es größere Menschengruppen und gesamte Naturzusammenhänge (z.B. das globale Ökosystem), die durch Moral einen Vorteil haben, so werden entsprechende Regeln eher verständlich und begründbar.
Von der moralischen Regel, die eine Person befolgt, profitiert ein größerer Zusammenhang, eine größere Einheit, deren Mitglied das moralische Individuum ist. Wer lediglich die Person, das Individuum und sein Genom als Einheit der Selektion betrachtet, kommt zu einer egoistischen Moral. Wer, wie der Autor, Selektion auf verschiedenen Ebenen betrachtet, kann den Vorteil moralischer Regeln für nicht egoistisches Verhalten gut erklären und evolutionsbiologisch begründen. So nutzen beispielsweise Familien, Stämme, Landsmannschaften, Nationen und transnationale Verbände bis hin zur gesamten Menschheit moralische Regeln.
Leben, Ökonomie, praktische Philosophie, Religion
Alter und das Alte gelten in den Massenmedien eher als schlecht. Jugendlichkeit ist höher im Kurs. Gegen das Altern soll Antiaging helfen, selbst wenn der Schuss in mehrfacher Weise nach hinten los geht. Auch die Warenwelt liebt das Neue, den Wechsel der Moden, die „Innovation“, um den Absatz der Güter zu fördern und immer weiter zu steigern.
Doch das Alte ist auch das Bewährte. Etwas das lange Bestand hat ist solide, gut gebaut, fest und widerstandsfähig. Das könnte man so ungefähr von alten Schuhen, ja auch von alten Menschen, oder von alten Moralvorstellungen sagen.
Die Dignität des Alten ist nicht zu unterschätzen.
In Religion oder Philosophie ist der Bezug auf Vorvormaliges nicht selten. Luther geht auf die Bibel zurück (ad fontes), Heidegger auf die Vorsokratiker.
Künstlich wird der Anschein hohen Alters erzeugt. Ein Beispiel gibt Martin Walser von einem Herren, der seine Anzugstoffe durch Lagerung in der Sonne ausbleichen lässt. Thomas Bernhard schreibt von dem Renomieren des Adels mit ältesten Lodenkleidungen. Unter 100 Jahren wäre es gar nichts wert. Auch für die Ahnentafel gilt, je länger, desto besser, am besten bis ins Neolithikum.
Die kleine Renaissance des alten, lateinischen Ritus in der katholischen Kirche ist ein ebensolches Stück Würde des Alten. Martin Mosebach schreibt hierüber.
Die Theologie geht über das Alte auf das schon immer Gewesene, das Ewige hinaus.