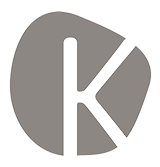praktische Philosophie
Ist Moral überhaupt notwendig oder kommt man besser ohne sie aus. Nietzsche erklärt die Überflüssigkeit und Schädlichkeit zumindest der Sklavenmoral wortgewaltig in mehreren Schriften und Aphorismen.
Moralische Grundsätze und Regeln, Maximen und moralische Traditionen und Gepflogenheiten sind erst dann nötig, wenn etwas erwünscht ist, aber zugleich mit Unannehmlichkeiten verbunden wird.
Für Dinge, die ohne Weiteres angenehm sind, braucht man keine moralischen Regeln. Nur das Unangenehme, das aufgrund eines angestrebten höheren Gutes erforderlich ist, nur dieser unangenehme Zustand, die lästige und beschwerliche Handlung, die anstrengende Haltung, benötigt die Moral. Wir sollen etwas tun was wir von alleine, ohne den moralischen Grundsatz, nicht tun würden.
Gerechtfertigt ist die Anstrengung, die Mühsal der moralischen Handlung durch den aus ihr zugleich folgenden höherwertigen Effekt. Das Gut, das durch die moralische Handlung erreicht wird, sollte die Mühen und Leiden deutlich überragen. Es sollte entscheidend größer sein als die Beschwernis der moralischen Haltung.
Interessant wird es, wenn Last und Gewinn einer moralischen Handlung auf verschiedene Personen verteilt sind. Dann hat einer die Mühe, der andere den Genuss. Man sollte also fragen, bei wem der Nutzen der moralischen Handlung liegt und wer die Kosten und Mühen, die Beschwernisse und Leiden trägt. Zudem muss nach der Verhältnismäßigkeit gefragt werden. Übersteigt der Ertrag die Kosten deutlich und vorhersagbar sicher? Ist der Ertrag real, so wie die Kosten und Mühen real sind? Oder sind die Anstrengungen wirklich, der Nutzen für einen selbst dagegen imaginär?
Kommen in einer hierarchischen Kultur die Beschwernisse, die von den unteren Schichten getragen werden, nicht nur den höheren Schichten zugute, sondern profitieren alle von einer ungleichen Lastenverteilung und einer nach Rängen gegliederten Gruppe von Menschen?
Oder sind alle besser dran, wenn alle annähend gleiche Lasten und Pflichten und auch annähernd gleiche Erträge und Genüsse haben? Die Frage ist hier die eines nach Rängen gegliederten oder eines egalitären Zusammenlebens der Menschen.
Möglicherweise sind Mischformen beider Ordnungen, Mischungen aus Hierarchie und aus Gleichheit, am stabilsten. Aber was wird wo gemischt und für wen?
praktische Philosophie
In der Evolutionstheorie spielte lange Zeit lediglich die Selektion von Individuen eine Rolle. Die Selektion und Fitness von Gruppen von Individuen wurde entweder bestritten oder als wenig bedeutend eingestuft.
Eine Schwierigkeit ist die Ausschließlichkeit mit der die Evolutionsbiologie die Vererbung an das Genom koppelt. (vgl. Video von W.D. Hamilton)
Andere Infomationsträger, wie die Meme, kulturell übertragen Informationen, sollen das Konzept ergänzen. Und es wird zunehmend gesehen, dass auf allen Ebenen, von der Nukleinsäure bis hin zu Galaxienhaufen, und möglicherweise sogar ganzen Universen, im Rahmen der Theorie multipler Universen, Selektion besteht. Auf allen Ebenen überleben die besser Angepassten und vermehren sich und die anderen Einheiten verschwinden, unterliegen, sterben aus …
Das gilt bei uns Menschen auch für Gruppen wie Familien, Dörfer, Stämme, Volksgruppen, Länder, supranationale Gemeinschaften und für die Menschheit insgesamt. Aber ebenso auch für Kunstrichtungen, Freundeskreise, Betriebe …
Leider wird aus verschiedenen Gründen, besonders aber weil der Weg der Informationsvererbung unklar scheint, die Evolution auf anderen Ebenen als dem Individuum zu wenig erforscht. Die multilevel selection theory steckt noch in ihren Kinderschuhen.
praktische Philosophie
Zum Kinderwahlrecht, von Geburt an, wurde am 27.6.08 ein Antrag an den deutschen Bundestag, Berlin, gestellt. Unterzeichnet ist der Antrag von 46 Abgeordneten aus CDU, CSU, SPD und FDP, darunter die frühere Familienministerin Renate Schmidt und Bundestags-Vizepräsident Wolfgang Thierse (beide SPD) sowie FDP-Generalsekretär Dirk Niebel, Renate Blank (CSU) und Michael Kretschmer (CDU).
Namhafte Unterstützer des Kinderwahlrechts sind u. a.
- der ehemalige Bundespräsident Roman Herzog. Roman Herzog war von 1983 bis 1994 Richter am Bundesverfassungsgericht und ab 1987 dessen Präsident.
- Paul Kirchhof ist Staatsrechtler in Heidelberg und war von 1987 bis 1999 Richter am Bundesverfassungsgericht.
Wenn man die Entwicklung des Wahlrechtes in Demokratien anschaut, ist das Wahlrecht für Kinder, treuhänderisch von den Eltern ausgeübt, folgerichtig.
Am Anfang hatten in den jungen Demokratien Englands oder Deutschlands nur die wohlhabenden, männlichen Bürger das Wahlrecht. So gab es in Preußen von 1849 bis 1918 ein „Dreiklassenwahlrecht“. Dabei wurde die Stimme des Wahlberechtigten männlichen Bürgers nach seinem Steueraufkommen gewichtet.
Die Gleichgewichtung der Stimmen und das Frauenwahlrecht wurden in Deutschland erst 1918 eingeführt. In der Schweiz kam das Frauenwahlrecht erst 1971. Die Schweiz ist das einzige Land, in dem die Männer den Frauen das Wahlrecht in einer Abstimmung erteilt haben.
Die Altersgrenze des Wahlrechts sinkt auch tendenziell. In Preußen waren die jungen Jahrgänge noch stark vertreten, sodaß bei Ausschluss aller Frauen und aller unter 25-Jährigen 1871 knapp 20% des deutschen Volkes ein Wahlrecht hatte.
In der Bundesrepublik Deutschland wurde 1971 die Altersgrenze des Wahlrechts von 21 auf 18 Jahre gesenkt. 1995 wurde in Nidersachsen das Wahlalter für Kommunalwahlen auf 16 Jahre gesenkt. Weitere Bundesländer folgten.
Heute ist durch die niedrigen Geburtenraten der Anteil von Kindern und Jugendlichen an der Bevölkerung dramatisch gesunken. Gleichzeitig steigen die Lasten, die diesen Kindern und jungen Menschen von den Entscheidungsträgern aufgebürdet und zugemutet werden.
Diese Belastungen durch Renten- und Sozialversicherungen und durch eine ungeheuerliche Staatsverschuldung soll auf immer weniger Schultern verteilt werden.
Hier ist es geboten, dass die kommenden Generationen schon jetzt durch das Wahlrecht Einfluss haben. Das Wahlrecht kann treuhänderisch von den Eltern ausgeübt werden.
Das verfassungsrechtliche Argument des Antrags an den deutschen Bundestag vom 27.6.08 ist die Volkssouveränität Artikel 20 Abs. 2 GG:
„(2) Alle Staatsgewalt geht vom Volke aus. Sie wird vom Volke in Wahlen und Abstimmungen und durch besondere Organe der Gesetzgebung, der vollziehenden Gewalt und der Rechtsprechung ausgeübt.“ (Hervorhebung K.K.)
Natürlich gibt es bei der Volkszugehörigkeit keine Altersbeschränkung. Auch Kinder und Jugendliche gehören zum Volk und üben nach dem Wortlaut des Art. 20 GG ihre Souveränität in Wahlen aus.
Dem steht der Artikel 38 Abs. 2 erster Halbsatz GG entgegen:
„(2) Wahlberechtigt ist, wer das achtzehnte Lebensjahr vollendet hat;“
Dieser Halbsatz soll nach dem Vorschlag der 46 Abgeordneten ersatzlos gestrichen werden.
Der Antrag favorisiert die treuhänderische Ausübung des Wahlrechtes durch die Eltern. Er setzt sich umsichtig mit den Argumenten gegen das Kinderwahlrecht auseinander und widerlegt diese, wie ich meine, überzeugend.
Referenz:
Deutscher Bundestag 16. Wahlperiode: Der Zukunft eine Stimme geben – Für ein Wahlrecht von Geburt an. Drucksache 16/9868, Abgerufen am 9. Juli 2008
Erziehung, praktische Philosophie
Klavierspielen muss den Kindern Spaß machen. Man kann die Kleinen doch nicht zu einem Instrument zwingen. Kindergarten, Schule, Sport, Freizeit, alles soll unseren Kindern Spaß machen.
Ich denke das ist vollkommen falsch. Kinder und Erwachsene sollten das tun, was richtig ist. Unabhängig davon, ob es gerade Spaß macht oder nicht. Ja gerade die, besonders anfängliche, Überwindung von Widerständen, die Überwindung von Trägheit und Unlust sind in der Erziehung und auch für die Selbstdisziplin das entscheidende Moment. Und wenn dann eine Aufgabe trotz Unlust und Unwillen, trotz anderer Widrigkeiten gemeistert wurde, entsteht Glück. Es ist das Glück auf dem Gipfel eines Berges nach dem beschwerlichen und mühsamen Aufstieg. Es ist die wirkliche Zufriedenheit nach getaner Arbeit.
Jedoch, wenn alles immer Spaß machen muss, dann kann man weder innere noch äußere Widerstände überwinden, dann wird man keine größeren Erfolge erreichen können, denn die kosten Schweiß und Mühen. Man wird sich lediglich im Seichten, Gewohnten und Bequemen aufhalten. Und man wird mit dieser schlappen Spaß-Einstellung letztlich, und hier liegt ein Paradox, weniger Spaß haben, als wenn man lernt, seine Pflicht zu tun, ganz unabhängig davon, ob es Spaß macht oder nicht.