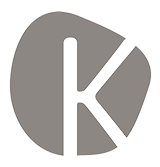Erziehung, Evolution, Gesundheit, Leben, praktische Philosophie, recht, Religion
Auflösung, Niedergang, Dekadenz sind die Zeichen der Gegenwart.
Besonders die Auflösung der Familien, das Auseinanderfallen der Generationen und das reihenweise Zerbrechen selbst der Kleinst- und Rumpffamilie sind zersetzend für unsere Gemeinschaft.
Die demographische Katastrophe ist bereits mit einer Geburtenrate in Deutschland von unter 1,4 Kindern pro Frau in vollem Gange.
Die Kultur der Sprache, der Künste, der Wissenschaften löst sich auf und wird durch eine Unterhaltungsindurstrie und hier besonders durch das Fernsehen ersetzt.
Traditionen, die weit besser waren als die Formlosigkeit und Haltlosigkeit durch die sie abgelöst wurden, sind vergessen oder werden nur noch als Attrappen gelebt.
Auch Grausamkeit und Menschenverachtung nehmen zu. Im Krieg sind Frauen, Kinder und Alte, Nichtkombattanten insgesamt schon seit langem Zielscheibe der Tötungsmaschinerien.
Anstand, Sittlichkeit, Gehorsam und Verantwortung lösen sich auf, verlieren an Inhalt und Bedeutung.
Und wo ist Rettung?
Evolution, Leben, praktische Philosophie, Religion
Je absurder der Inhalt, desto gemeinschaftsstiftender die Wirkung und der mit der Zugehörigkeit zur Gemeinschaft verbundene Selektionsvorteil.
Glaubensbekenntnisse ideologischer oder religiöser Natur haben, so denke ich, nicht vorwiegend den vermeintlichen Inhalt der Aussage zum Gegenstand.
Die Hauptfunktion dürfte vielmehr das Signal der Konformität sein, des Dazugehörens, des Mitmachens, des „ich bin auch dabei, ich gehöre zu euch, wir gehören zusammen“.
Das Bekenntnis ist also vermutlich nicht so sehr auf der rationalen, inhaltlichen Ebene bedeutsam, sondern als Bekenntnis der Gruppenzugehörigkeit.
Evolutionsbiologisch ergibt sich aus der Zugehörigkeit zu einer Menschengruppe ein bedeutender, ja ein über Leben und Tod entscheidender Vorteil. Das ausgeschlossen sein, das nicht mehr Dazugehören, der Ostrazismus, bedeuteten früher den ziemlich sicheren Tod.
Die Menschen haben ein tief verwurzeltes Gespür für die Gefahr in Widerspruch zur eigenen Gruppe zu geraten. Deshalb wird zu vielfachen Anlässen und Gelegenheiten die Zugehörigkeit bekräftigt. Das mag durch Riten, durch den Gestus, durch das äußere Erscheinungsbild geschehen oder durch verbale Äußerungen und (Lippen-)Bekenntnisse.
Der vordergründige Inhalt, beispielsweise die Aussage man glaube an die jungfräuliche Geburt Jesu, ist dabei nicht so sehr wesentlich. Es muss im Grunde genommen gar nicht aufrichtig gemeint sein. Viel wichtiger bei dergleichen Äußerungen ist das Bekenntnis der Zugehörigkeit, der Zusammengehörigkeit.
Selbst Immanuel Kant kroch auf diese Weise mit seiner kleinen Spätschrift zur Religion zu Kreuze.
Die Distanz, der Widerspruch zum herrschenden Glauben, das Nichtdazugehören zur Religions- oder Ideologiegemeinschaft hat vielfältige Nachteile. Der Dissident wird gemieden. Er ist in Gefahr. Im katholischen Polen des 18. Jahrhunderts war er in Gefahr, geköpft zu werden. Und noch davor wurden in ganz Europa Ketzer eifrig verbrannt.
Der Selektionsvorteil des Konformismus liegt somit auf der Hand, auch heute noch. Das Bekenntnis die herrschende Lehre zu glauben, auch, und gerade wenn sie noch so absurd ist, hilft beim Überleben und sich Vermehren in einer Gruppe.
Zu fragen wäre auch in die entgegengesetzte Richtung, ob denn der Dissens, der Widerspruch zur herrschenden Ideologie, die Verweigerung von Bekenntnissen der Dazugehörigkeit, ebenso und auf verschiedene Weise Selektionsvorteile bieten.
Das mag bei der Gruppenselektion dann so sein, wenn der Dissens in einer Gemeinschaft von verschworenen „Ungläubigen“ und „Widerständlern“ gelebt wird. Dann übernimmt der Glaube an den Dissens die Rolle der Gemeinschaftsstiftung. Der enorme und noch stärkere Gruppenzwang von Protest- und Widerstandsgruppen ist auf diese Weise eine alternative Gemeinschaftsstiftung und verhilft so zu einem Selektonsvorteil in der Gruppe, nur eben in einer oppositionellen Gruppe. Wenn dann die Dissidentengruppe auch noch im Laufe der Zeit zur neuen herrschenden Richtung wird, hat man auf das richtige Pferd gesetzt. Der Dissens wird zum Konsens, zum Mainstream. Die Ideologie der Revolutionäre wird zum Glauben der herrschenden Gewalten. Für das Bekenntnis zu dieser Glaubensrichtung gilt das oben gesagte.
Das Bekenntnis der Zugehörigkeit hat um so mehr Wert, je absurder der vorgebliche Inhalt ist. Je irrationaler die Behauptungen der Glaubensbekenntnisse, desto nachdrücklicher wirken sie als Konformitätsaussagen, als Versicherungen darüber, dabei zu sein, mit zu machen, dazu zu gehören. Dieser Wert der Konformitätsaussage ist größer bei absurden, irrationalen Inhalten, die sich empirisch, rational in keinster Weise nachvollziehen lassen. Es ist ein Zeichen dafür, wie viel einem die Zugehörigkeit wert ist, es ist der „Mitgliedsbeitrag“ als teilweiser Verzicht auf Rationalität, als Fürwahrhalten völlig unzureichend bewiesener Aussagen. Hinzu kommt bei der Gruppenzugehörigkeit noch der Beitrag an Geld, Arbeitskraft, Zeit, menschlicher Zuwendung, Lernen und Weitergeben der ideologischen Reden und Erzählungen … Es wird so der handfeste Beweis geliefert wie viel einem die Zugehörigkeit wert ist, welchen Preis, auch an Rationalität, man zu zahlen bereit ist.
Ich habe über diesen religionsphilosophischen Zusammenhang noch nirgendwo gelesen. Tertullians Satz, „Certum est, quia impossibile“, der später als „Credo quia absurdum“ kolportiert wird, nennt den Glauben an das Widersinnige, das Absurde, bezeichnet aber nicht die Funktion der Gemeinschaftstiftung gerade durch widersinnige Glaubenssätze („Certum est, quia impossibile“ – „Es ist gewiss, weil unmöglich“ „Credo quia absurdum“ – „Ich glaube weil es widersinnig ist“). Auch die Abgrenzung gegen andere Gruppen dürfte mit widersinnigen Dogmen besser gelingen. Common sense, das allgemein Akzeptierte und unmittelbar Einsichtige, das überall als bewiesen Geltende, taugt nicht zur Gruppenbildung und Abgrenzung gegen die „Ungläubigen“.
Religion
Die wahre Religion, man höre und staune, denn jetzt kommt die letztgültige Klärung des lange in blutigsten Kämpfen ausgefochtenen Streits, die wahre Religion ist schlicht unser Leben im Universum. Wir können aus diesem Leben nicht austreten, wie aus einer Kirche, und ein anderes führen. Die wahre Religion ist unmittelbar unser Leben, verständig oder unverständig, voll Bewunderung für das Weltall oder abgestumpft.
Was sich als konkrete Religion in Messen, Riten, Lebensregeln … manifestiert, ist demgegenüber sehr abgeleitet, oft sehr beschränkt, fanatisch, besserwisserisch und manchmal auch lächerlich.
Leben, Ökonomie, praktische Philosophie, Religion
Alter und das Alte gelten in den Massenmedien eher als schlecht. Jugendlichkeit ist höher im Kurs. Gegen das Altern soll Antiaging helfen, selbst wenn der Schuss in mehrfacher Weise nach hinten los geht. Auch die Warenwelt liebt das Neue, den Wechsel der Moden, die „Innovation“, um den Absatz der Güter zu fördern und immer weiter zu steigern.
Doch das Alte ist auch das Bewährte. Etwas das lange Bestand hat ist solide, gut gebaut, fest und widerstandsfähig. Das könnte man so ungefähr von alten Schuhen, ja auch von alten Menschen, oder von alten Moralvorstellungen sagen.
Die Dignität des Alten ist nicht zu unterschätzen.
In Religion oder Philosophie ist der Bezug auf Vorvormaliges nicht selten. Luther geht auf die Bibel zurück (ad fontes), Heidegger auf die Vorsokratiker.
Künstlich wird der Anschein hohen Alters erzeugt. Ein Beispiel gibt Martin Walser von einem Herren, der seine Anzugstoffe durch Lagerung in der Sonne ausbleichen lässt. Thomas Bernhard schreibt von dem Renomieren des Adels mit ältesten Lodenkleidungen. Unter 100 Jahren wäre es gar nichts wert. Auch für die Ahnentafel gilt, je länger, desto besser, am besten bis ins Neolithikum.
Die kleine Renaissance des alten, lateinischen Ritus in der katholischen Kirche ist ein ebensolches Stück Würde des Alten. Martin Mosebach schreibt hierüber.
Die Theologie geht über das Alte auf das schon immer Gewesene, das Ewige hinaus.
Erziehung, Evolution, Leben, Ökonomie, praktische Philosophie, Religion
Äußerlichkeiten werden in der Absicht gepflegt einen günstigeren Eindruck auch vom Inneren zu geben. So hilft schöne Kleidung über den nicht ganz so attraktiven Körper hinweg und Zeichen des Wohlstandes, Statussymbole, sollen den Eindruck von Vermögen erzeugen, das so nicht vorhanden ist. Gefärbte Haare, geliftete Haut, vorzugsweise im Gesicht, vermitteln Jugendlichkeit, wenn diese innerlich schwindet.
All diese Bemühungen sind kontraproduktiv, wenn, und das ist oft der Fall, die Diskrepanz zwischen Innen und Außen bemerkt wird. Der auf jung getrimmte ältere Mensch wirkt absurd und lenkt durch seine vergeblichen Bemühungen die Aufmerksamkeit gerade auf sein Alter. Der beruflich nicht Erfolgreiche macht durch ostentative Symbole des materiellen Erfolges auf das mitunter Verzweifelte seiner Lage noch mehr aufmerksam.
Zudem zeigt der äußerlich bemühte Mensch, dass er sein Inneres, das er zu verbergen sucht und über das er täuschen möchte, nicht für angemessen und wertvoll hält. Der Blender hat ein schlechtes Selbstwertgefühl.
Und dann kommt noch die Angst vor der Entdeckung, die unfrei macht.
Das Innere „authentisch“ nach Außen gekehrt ist nicht die richtige Alternative.
Das was nach Außen getragen wird, sei es durch Lebensführung, Kleidung und Gestaltung sollte nicht alles offenbaren müssen, sondern es sollte frei von der Absicht sein einen günstigeren Eindruck zu erwecken. Es sollte ohne Effekt sein.
Die Wirtschaft lebt gut vom schönen Schein. Die Werbung zelebriert ihn und ist damit die heilige Messe einer imaginären Welt, in der scheinbar junge, kluge, ausgeglichene, wohlhabende, schöne … Menschen leben.
Die Mengen an Zeit und Geld, die für den äußeren Anschein aufgewendet werden, sind enorm. Die Bauwirtschaft, die Modeindustrie, die Kosmetik, Autohersteller … leben zu einem hohen Anteil von der Neigung mehr zu scheinen als zu sein.
Die Gegenbewegung, weniger Schein als Sein ist sympathischer und noch entspannter ist ein ausgeglichenes, nicht aber ungefiltertes Verhältnis von dem, was ist und dem was gezeigt wird.
Evolution, Religion, Wissenschaft
Merkt der Fisch im Wasser, dass er nass ist?
Womit wir räumlich und zeitlich unterschiedslos umgeben sind, fällt uns nicht auf. Wir reagieren mit unserer Wahrnehmung, mit unserem Denken, Fühlen, der Stimmung, mit unserem ganzen geistigen Apparat auf Veränderungen. Das immer Gleiche hat für unser Bewusstsein keine Bedeutung, es erfordert keine Reaktion und die Perzeption brächte keinen Selektionsvorteil in der Entwicklungsgeschichte.
Die Veränderung fällt uns auf. Das ist schon bei taktilen Reizen so. Bewegung auf der Haut, beispielsweise, wird stärker wahrgenommen, als gleichbleibender Druck. Die Veränderungen im Vermögen, plötzlicher Wohlstand oder unerwartete Armut, sind weit eher spürbar, als eine Beständigkeit der Verhältnisse.
Ebenso ist es mit dem Erstaunlichen. Es wird nicht im Alltäglichen gesehen. Das Besondere, das Großartige, das Göttliche wird im Wunder bemerkt. So erwartet die katholische Kirche noch heute bei der Heiligsprechung bewiesene Wunder.
Diese Wunder erscheinen mittlerweilen unglaubwürdig und geringfügig, verglichen mit den erstaunlichen Erkenntnissen der Naturwissenschaften. Zudem behaupten die Wunder die Strukturen (Regelmäßigkeiten, Theorien und Gesetze) der Alltagserfahrung und auch des naturwissenschaftlichen Weltbildes außer Kraft zu setzen.
Die Naturwissenschaften, die Mathematik und andere Geisteswissenschaften, die Kunst, das „Abenteuerliche“ im Leben, der Ausbruch aus dem Gewohnten und Vertrauten, das Durchbrechen der „Komfortzone“, bringen andere Sichtweisen und überschreiten die Alltagserfahrung.
Das Wunder wird in diesen Ausbrüchen über die Alltagserfahrung, über das gewohnte Einerlei hinaus glaubwürdig erfahrbar. Damit können traditionelle religiöse Wundergeschichten nicht konkurrieren. Sie verblassen, sind unglaubwürdig und abstrus.
Das Bedürfnis nach dem Außergewöhnlichen, dem Wunderbaren ist legitim und findet auf moderne Art seine Befriedigung.
Beschluß.
|
|
|
|
| |
33 |
Zwei Dinge erfüllen das Gemüth mit immer neuer und zunehmender |
|
|
|
| |
34 |
Bewunderung und Ehrfurcht, je öfter und anhaltender sich das Nachdenken |
|
|
|
| |
35 |
damit beschäftigt: der bestirnte Himmel über mir und das |
|
|
|
| |
36 |
moralische Gesetz in mir. |
[I. Kant: Kritik der praktischen Vernunft, (AA V), Seite 161]
Edward O. Wilson schreibt in seinem Buch über die Einheit des Wissens, dass die Erkenntnisse der naturwissenschaftlichen Forschung endlos mehr Grandeur besitzen, als die Wundergeschichten der Religionen. Ich glaube er benutzte dieses Wort „Grandeur“, leider finde ich gerade das Buch und die Stelle nicht – wieder ein guter Grund für digitale Bücher, am besten in der Wissenswolke, der cloud.
In der Tat ist der Unterschied naturwissenschaftlicher Erkenntnisse zu unserer Alltagserfahrung noch viel gewaltiger, als wenn Jesus Christus Blinde sehen macht, über Wasser geht, oder Lahme zum Laufen bringt. Den Wesentlichen Punkt des Wunderbaren, den Unterschied zum Gewohnten, beschreibt Wilson nicht. Auch nicht den Wunsch und den Grund des Bedürfnisses der Menschen nach dem Erhabenen, dem Außergewöhnlichen und Göttlichen.