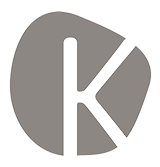Religion, Wissenschaft
Isaac Newton gilt als einer der größten Naturwissenschaftler. Und doch ist gleichzeitig sein Schrifttum zu religiösen Themen äußerst umfangreich. Er betrieb ausgedehnte Studien, unter anderem zu den Kirchenvätern.
Die Faszination des Religiösen und das Erstaunen über die physikalische Natur scheinen hier zusammen zu gehen.
Erziehung, Evolution, praktische Philosophie, Wissenschaft
Dem konservativen, im Grunde reaktionären „früher war alles besser“ gebe man zu bedenken, dass von Generation zu Generation die Menschen intelligenter werden. Das mag sich in den allerletzten Jahren etwas abschwächen. Der Effekt wurde von dem neuseeländischen Politologen James R. Flynn beschrieben.
Es drängt sich manchmal bei der Rede von der guten alten Zeit der Verdacht auf, dass lediglich der Redner damals besser in Schuss war und heute einige Zeichen von Verfall am eigenen Körper und Geist zeigt.
Religion, Wissenschaft
„Being a lover of freedom, when the revolution came in Germany, I looked to the universities to defend it, knowing that they had always boasted of their devotion to the cause of truth; but, no, the universities immediately were silenced. Then I looked to the great editors of the newspapers whose flaming editorials in days gone by had proclaimed their love of freedom; but they, like the universities, were silenced in a few short weeks. …
Only the Church stood squarely across the path of Hitler’s campaign for suppressing truth. I never had any special interest in the Church before, but now I feel a great affection and admiration because the Church alone has had the courage and persistence to stand for intellectual truth and moral freedom. I am forced thus to confess that what I once despised I now praise unreservedly.“
[Albert Einstein, TIME, 23 September 1940]
Das bedingungslose Festhalten an Überzeugungen, an Glaubenswahrheiten, zeichnet gerade den konservativen, traditionsorientierten Katholizismus aus.
Demgegenüber ist die Wissenschaft bereit, Überzeugungen aufzugeben, Theorien zu ändern und Anschauungen zu verwerfen. Das ist eine Stärke in der Weiterentwicklung des Wissens, kann aber auch eine Schwäche sein, wenn der Meinungsumschwung, vielleicht sogar unbewusst, auf politischen Druck hin erfolgt. Dann ist es nicht die objektive Forschung nach der Wahrheit, die den Wechsel der Auffassung bringt, sondern man legt sich die „Wahrheit“ so zurecht, wie man sie haben möchte oder auf äußeren Druck hin zurechtbiegen muss. Die Sophisten waren die ersten überlieferten Meister hierin.
Aber man muss auch sehen, dass Einsteins zitierte Auffassung ohne historischen Abstand geäußert wurde. Es gab in der Wissenschaft, in der Presse Widerstand und es gab auch in den christlichen Kirchen Mitläufer des Regimes.
Evolution, Ökonomie, Wissenschaft
Spiegelt die Evolutionstheorie die marktwirtschaftliche Ordnung? Die Parallelen sind verblüffend. Es treten Mutationen oder neue Unternehmen auf. Diese sind besser oder schlechter angepasst. Sie wachsen oder vergehen. Die Dynamik im Gegensatz zur statischen, mittelalterlich verfassten Gesellschaft ist nicht zu übersehen.
Ist damit die bürgerliche Gesellschaft die natürliche Ordnung? Ich denke kaum. Welche Ordnung werden wir in der Zukunft haben und wie wird sie unsere Theoriebildungen beeinflussen?
Und dann ist Einiges der evolutionstheoretischen Erklärungen auch zirkulär, d.h. es sind Scheinerklärungen. So überlebt und vermehrt sich das Individuum, das am besten angepasst ist. Und der Grad der Anpassung wird am Erfolg des Überlebens und Reproduzierens gemessen. Der mit der besten fitness vermehrt sich. Und der, der sich am erfolgreichsten vermehrt, hat die beste fitness.
Leben, praktische Philosophie, Wissenschaft
Eine trockene, nüchterne Stimmung erleichtert den realistischen Blick auf Menschen, Dinge, auf sich selbst und die Zeit.
Auch nur leichte Überspanntheiten, Euphorie, Depression verfälschen und ziehen Fehler nach sich.
Beständig, fleißig, sachlich und gründlich, sozusagen wissenschaftlich eingestellt, scheint die Realität am klarsten, Irrtümer am unwahrscheinlichsten.
Evolution, Religion, Wissenschaft
Merkt der Fisch im Wasser, dass er nass ist?
Womit wir räumlich und zeitlich unterschiedslos umgeben sind, fällt uns nicht auf. Wir reagieren mit unserer Wahrnehmung, mit unserem Denken, Fühlen, der Stimmung, mit unserem ganzen geistigen Apparat auf Veränderungen. Das immer Gleiche hat für unser Bewusstsein keine Bedeutung, es erfordert keine Reaktion und die Perzeption brächte keinen Selektionsvorteil in der Entwicklungsgeschichte.
Die Veränderung fällt uns auf. Das ist schon bei taktilen Reizen so. Bewegung auf der Haut, beispielsweise, wird stärker wahrgenommen, als gleichbleibender Druck. Die Veränderungen im Vermögen, plötzlicher Wohlstand oder unerwartete Armut, sind weit eher spürbar, als eine Beständigkeit der Verhältnisse.
Ebenso ist es mit dem Erstaunlichen. Es wird nicht im Alltäglichen gesehen. Das Besondere, das Großartige, das Göttliche wird im Wunder bemerkt. So erwartet die katholische Kirche noch heute bei der Heiligsprechung bewiesene Wunder.
Diese Wunder erscheinen mittlerweilen unglaubwürdig und geringfügig, verglichen mit den erstaunlichen Erkenntnissen der Naturwissenschaften. Zudem behaupten die Wunder die Strukturen (Regelmäßigkeiten, Theorien und Gesetze) der Alltagserfahrung und auch des naturwissenschaftlichen Weltbildes außer Kraft zu setzen.
Die Naturwissenschaften, die Mathematik und andere Geisteswissenschaften, die Kunst, das „Abenteuerliche“ im Leben, der Ausbruch aus dem Gewohnten und Vertrauten, das Durchbrechen der „Komfortzone“, bringen andere Sichtweisen und überschreiten die Alltagserfahrung.
Das Wunder wird in diesen Ausbrüchen über die Alltagserfahrung, über das gewohnte Einerlei hinaus glaubwürdig erfahrbar. Damit können traditionelle religiöse Wundergeschichten nicht konkurrieren. Sie verblassen, sind unglaubwürdig und abstrus.
Das Bedürfnis nach dem Außergewöhnlichen, dem Wunderbaren ist legitim und findet auf moderne Art seine Befriedigung.
Beschluß.
|
|
|
|
| |
33 |
Zwei Dinge erfüllen das Gemüth mit immer neuer und zunehmender |
|
|
|
| |
34 |
Bewunderung und Ehrfurcht, je öfter und anhaltender sich das Nachdenken |
|
|
|
| |
35 |
damit beschäftigt: der bestirnte Himmel über mir und das |
|
|
|
| |
36 |
moralische Gesetz in mir. |
[I. Kant: Kritik der praktischen Vernunft, (AA V), Seite 161]
Edward O. Wilson schreibt in seinem Buch über die Einheit des Wissens, dass die Erkenntnisse der naturwissenschaftlichen Forschung endlos mehr Grandeur besitzen, als die Wundergeschichten der Religionen. Ich glaube er benutzte dieses Wort „Grandeur“, leider finde ich gerade das Buch und die Stelle nicht – wieder ein guter Grund für digitale Bücher, am besten in der Wissenswolke, der cloud.
In der Tat ist der Unterschied naturwissenschaftlicher Erkenntnisse zu unserer Alltagserfahrung noch viel gewaltiger, als wenn Jesus Christus Blinde sehen macht, über Wasser geht, oder Lahme zum Laufen bringt. Den Wesentlichen Punkt des Wunderbaren, den Unterschied zum Gewohnten, beschreibt Wilson nicht. Auch nicht den Wunsch und den Grund des Bedürfnisses der Menschen nach dem Erhabenen, dem Außergewöhnlichen und Göttlichen.