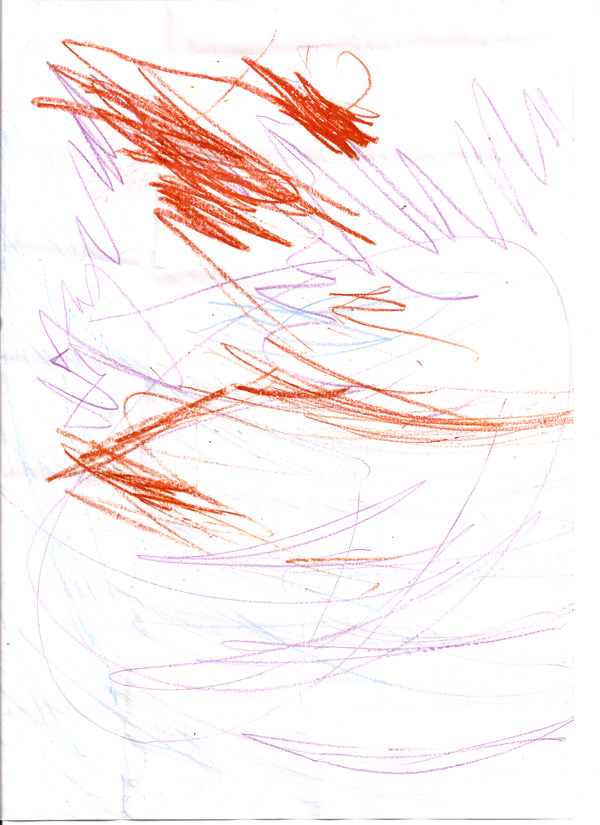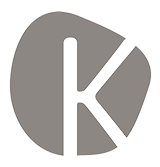demokratie
In einer wesentlich repräsentativen Demokratie übernimmt eine Regierung die Staatsgeschäfte und nicht das Volk. So herrscht nicht das Volk selbst (δήμος = Volk), sondern eine sozusagen gewählte Aristokratie. Und diese muss sich zumindest bei Wahlen messen lassen an alternativen Gruppen, den oppositionellen Parteien, Vereinigungen etc..
Einer Diktatur bleibt dieses Kräftemessen nach formalen Regeln erspart, sie muss sich nicht im Wettbewerb um die besseren politischen Lösungen beweisen. Wenn eine Diktatur zunächst mächtig und stark erscheint, so ist sie tatsächlich aus diesem Grunde wesentlich schwach und schwächer als eine Demokratie in der die herrschende Regierung immer den Wettstreit gegen die Opposition bestehen muss.
Wer somit eine wirklich starke Regierung will, muss eine echte Demokratie wollen, mit Verfassung, mit Rechtsstaatlichkeit, mit starken Oppositionen, mit wirklicher Meinungsfreiheit und der Möglichkeit offener Diskussion.
roter faden
roter faden:
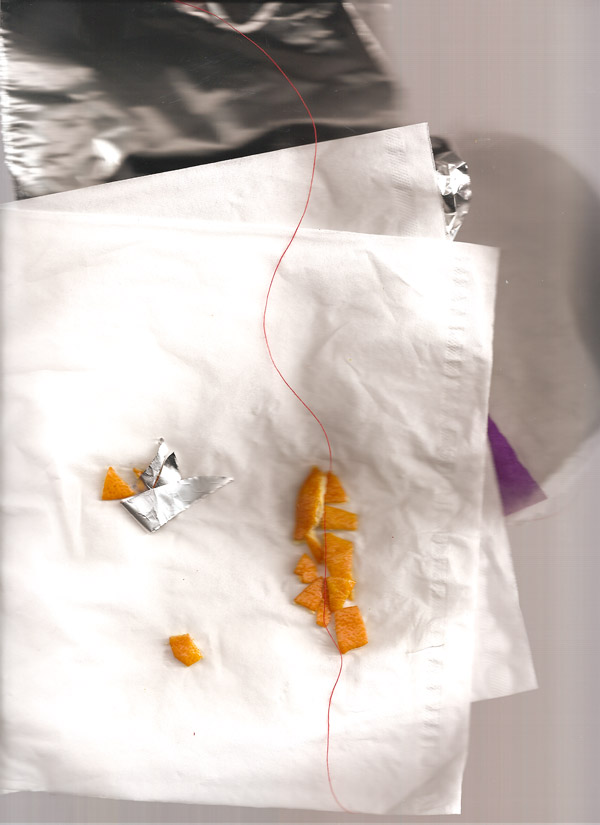
wirklich
Über die Wirklichkeit äußern sich die Menschen durch Zeichen und Sprachen. Diese Zeichen beziehen sich auf reale und weniger reale Sachen.
Das reicht von den menschheits- und individualgeschichtlichen Anfängen des Sprechens bis zur höheren Mathematik und den Sprachen der Natur-, Gesellschafts- und Geisteswissenschaften.
Diese Zeichensysteme mit ihrem Bezug auf die Realität sind selbst wiederum ein Teil der Wirklichkeit.
Ein Dualismus, oder wie Popper vorschlägt, eine Teilung in drei Welten, erscheint nicht nötig. Es geht einfacher durch eine einzige Realität zu der Sprachen, Zeichen und auch Bewusstsein dazugehören.
Das Absolute ist dann nicht so sehr und vorwiegend durch die Rede davon gegeben, sondern durch die gesamte Wirklichkeit zu der diese unterschiedlichen Reden vom Absoluten, vom Ganzen in den verschiedenen Religionen, Weltanschauungen und Wissenschaften selbst als winzige Teilmengen gehören.
Wer sich darüber ins Klare setzt wird bescheiden, tolerant und skeptisch.
transparent
„Zweitens muss es eine Aufsicht über die Aufsicht geben, die dafür sorgt, dass sich die Regeln mindestens europaweit wettbewerbsneutral umgesetzt werden. [Beatrice Weder di Mauro, eine der fünf deutschen Wirtschaftsweisen im Handelsblatt 12.11.08]“
Eine Aufsicht der Aufsicht, und wer kontrolliert die Aufsicht der Aufsicht? Und so fort …
Das wird zu einem unendlichen Regress der Kontrollinstanzen. Hier liegt gewiss keine Rettung, lediglich ein Wuchern der Bürokratie, 22 Schiedsrichter und Oberschiedsrichter und Oberoberschiedsrichter usw. und nur noch 2 Spieler auf dem Feld.
Was hilft ist vielmehr Transparenz, wirkliche Öffentlichkeit. Dadurch wird jedem die Möglichkeit gegeben zu kontrollieren.
Im Prinzip und der Möglichkeit nach sind dann alle Kontrolleure, der Regress ist vermieden, die Öffentlichkeit in entscheidenden Bereichen, wie der Wirtschaft, hergestellt.
leicht
Leicht sieht es aus, wenn einer seine Sache beherrscht. Fast so, dass man versucht wäre zu meinen, man könne das auch. Es sieht wirklich einfach aus, mühelos, selbstverständlich, routiniert, spielerisch und so, als mache es Spaß.
Dementgegen wirkt die Beteuerung, das was man mache, sei höchst schwierig, äußerst kompliziert und erfordere höchstes Können, ganz und gar plump, ja es entsteht der Verdacht, man habe es nicht mit einem wirklichen Könner zu tun. Der, der die Schwierigkeiten seiner Arbeit so hervorkehrt, setzt sich dem Misstrauen aus, und ihm wird, bisweilen zu Recht, unterstellt, er beherrsche das Ding doch nicht so richtig. Vielleicht will er auch nur den Preis der Angelgenheit in die Höhe treiben, wenn er beständig versichert, wie schwierig, wie komplex und zeitaufwendig das alles ist.
Nietzsche ist in diesem Sinn der Philosoph der Leichtigkeit, der Kraft, des Lachens und des Tanzes. Der Wille zur Macht lässt das Schwere, das Schwache, das Müde und Bemühte hinter und unter sich.
rakete 2
rakete 2:
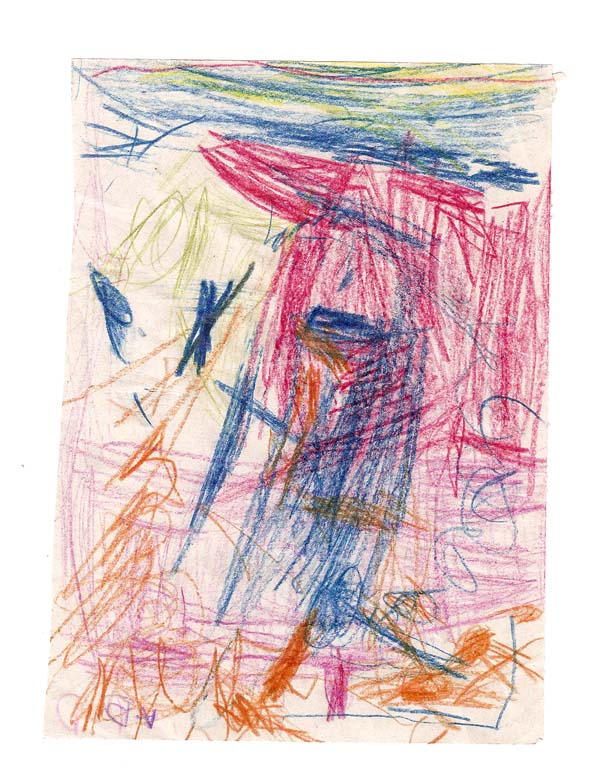
negative theologie
Über die Götter oder das Göttliche oder über Gott könne nichts Bestimmtes ausgesagt werden.
Seit der griechischen Philosophie wird dieser Vorbehalt geäußert. Auch im Christentum, besonders in der christlichen Mystik, gibt es eine negative Theologie.
Wie weit ist negative Theologie jedoch Agnostik? Streng genommen müsste man ja, sofern man vom Göttlichen nichts sagen kann und darf, auch darüber in Unkenntnis sein, dass es das „Göttliche“ oder ein „Gott“ ist, über den man nichts weiß und sagen kann.
Hier hat der Agnostizismus ein Einfallstor zur Theologie, und umgekehrt hat die Theologie über die negative Theologie eine Möglichkeit in den Agnostizismus zu entweichen.
100 meter
Wie beim Hundermeterlauf, so gibt es bei jedem Wettkampf und Wettbewerb zwei Methoden um besser zu sein als die anderen.
Einmal gibt es den fairen Weg durch hervorragende eigene Leistung die anderen zu überbieten.
Andererseits existiert auch der unfaire Weg. Einmal liegt der darin den anderen zu schaden. Des weiteren ist es ebenso unfair durch unlautere Mittel die eigene Leistung zu steigern.
test
Tests und Prüfungen sind nicht sehr beliebt. Man muss sich vorbereiten. Das ist anstrengend und kostet Überwindung. Die Anstrengung wird mitunter aufgeschoben. Vor der Prüfung steigt die Aufregung …
Aber Prüfungen haben einen entscheidenden Nutzen. Der Geprüfte hat seine Fähigkeit bewiesen.
Und jemand der diesem geprüften Menschen vertrauen muss, hat mehr Zuversicht, hat mehr Gewissheit über dessen Qualifikation.
In Bereichen besonderer Verantwortung, wie der Medizin oder dem Rechtswesen, sind staatliche Prüfungen, Staatsexamina vorgesehen.
Was aber macht eine Prüfung aus, die diesen Namen verdient.
Unter anderem ist es eine Durchfallquote. Eine Prüfung, die jeder besteht, ist so gut wie gar keine Prüfung. Prüfungen erfüllen erst dann ihren eigentlichen Sinn, wenn sie nicht jeder, der zugelassen ist, besteht.
Weitere Eigenschaften guter Prüfungen sind Objektivität und Sachbezogenheit.
Nicht subjektive Vorlieben der Prüfer dürfen entscheiden, sondern die sachliche Bewertung der Leistungen und Fähigkeiten der Prüflinge. Am besten erfolgt die Bewertung der Prüfungsleistung blind, ohne dass der Prüfer weiß welche Person hinter dieser Leistung steht.
Die Sachbezogenheit einer Prüfung ist ebenso wichtig. Man sollte genau überlegen, was geprüft wird, damit die Prüflinge für ihre angestrebte Tätigkeit richtig ausgewählt, richtig selektiert werden können.
ostern
ostern:

ausschnitt von „ostern“:

kreise
kreise
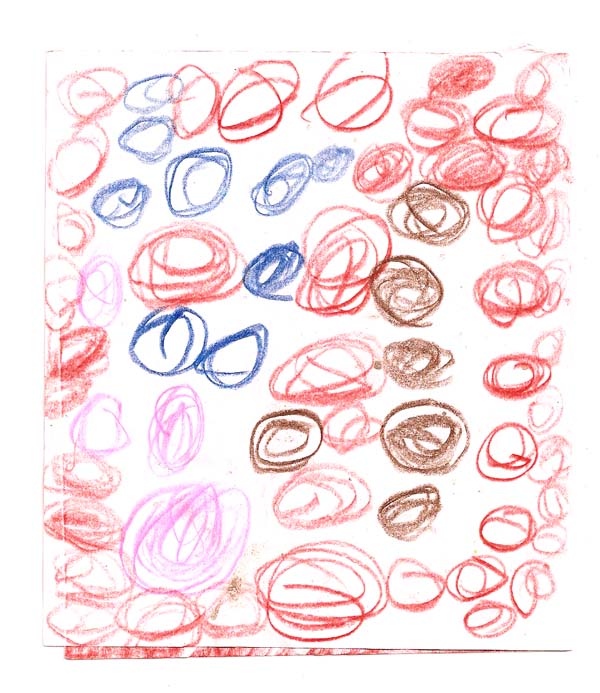
regelmäßig
Einfache, regelmäßige Tätigkeiten zeigen oft erstaunliche Resultate.
Vielleicht hat Ernst Jünger auch durch sein morgendliches, kaltes Bad ein so hohes Alter erreicht.
Sport und geistige Fähigkeiten verlangen beständiges, ausdauerndes Üben. Imgleichen ist es bei der Musik.
Große Berge werden mit kleinen Schritten bestiegen. Und wer erst einmal den Anfang geschafft hat, der geht oft ohne Mühe weiter.
introvertiert
Introversion ist weiter verbreitet als es scheint. Das liegt in der Natur der Sache. Introvertierte Menschen treten nicht so sehr nach außen hin auf. Sie bilden keine Netzwerke, ihr „networking“ nähert sich der Nulllinie. Sie gründen keine Gesellschaften, Vereine, sitzen nicht in Talkshows und tummeln sich nicht auf Bällen oder Kongressen.
Sie werden in ihrer Zahl zumindest unterschätzt.
Gelegentlich aber haben sie einen öffentlichen Auftritt.
Eine dieser Epiphanien bildete das Gespräch in einer amerikanischen Talkshow mit dem ehemaligen Vorsitzenden der us-amerikanischen Notenbank(en) Federal Reserve System, Alan Greenspan. In der Charly Rose Show bezeichnete sich Greenspan als extrem introvertierten Menschen. Das ist bemerkenswert, wenn man die öffentliche Position bedenkt, die er 1987 bis 2006 inne hatte.
Noch besser als dieses Geständnis einer starken Introvertiertheit in einer Fernsehtalkshow gefällt mir allerdings die Beschreibung des Protagonisten aus „Die Blendung“ von Elias Canetti. Peter Kien, die Hauptfigur des Romans, bemerkt nicht ein mal, dass ein Passant mit ihm spricht und sich nach dem Ort erkundigt. Kien redet nicht auf Kongressen zu seinem Fachgebiet und scheut jeden Kontakt mit „den Menschen“, bis er dann in weltfremder Art aus praktischen Erwägungen heraus seine Haushälterin ehelicht … Die folgenden sehr menschlichen Verwicklungen sind für den an Introversion als reinem Zustand interessierten nicht mehr lesenswert.
residenzgarten

glaubensbekenntnisse
Je absurder der Inhalt, desto gemeinschaftsstiftender die Wirkung und der mit der Zugehörigkeit zur Gemeinschaft verbundene Selektionsvorteil.
Glaubensbekenntnisse ideologischer oder religiöser Natur haben, so denke ich, nicht vorwiegend den vermeintlichen Inhalt der Aussage zum Gegenstand.
Die Hauptfunktion dürfte vielmehr das Signal der Konformität sein, des Dazugehörens, des Mitmachens, des „ich bin auch dabei, ich gehöre zu euch, wir gehören zusammen“.
Das Bekenntnis ist also vermutlich nicht so sehr auf der rationalen, inhaltlichen Ebene bedeutsam, sondern als Bekenntnis der Gruppenzugehörigkeit.
Evolutionsbiologisch ergibt sich aus der Zugehörigkeit zu einer Menschengruppe ein bedeutender, ja ein über Leben und Tod entscheidender Vorteil. Das ausgeschlossen sein, das nicht mehr Dazugehören, der Ostrazismus, bedeuteten früher den ziemlich sicheren Tod.
Die Menschen haben ein tief verwurzeltes Gespür für die Gefahr in Widerspruch zur eigenen Gruppe zu geraten. Deshalb wird zu vielfachen Anlässen und Gelegenheiten die Zugehörigkeit bekräftigt. Das mag durch Riten, durch den Gestus, durch das äußere Erscheinungsbild geschehen oder durch verbale Äußerungen und (Lippen-)Bekenntnisse.
Der vordergründige Inhalt, beispielsweise die Aussage man glaube an die jungfräuliche Geburt Jesu, ist dabei nicht so sehr wesentlich. Es muss im Grunde genommen gar nicht aufrichtig gemeint sein. Viel wichtiger bei dergleichen Äußerungen ist das Bekenntnis der Zugehörigkeit, der Zusammengehörigkeit.
Selbst Immanuel Kant kroch auf diese Weise mit seiner kleinen Spätschrift zur Religion zu Kreuze.
Die Distanz, der Widerspruch zum herrschenden Glauben, das Nichtdazugehören zur Religions- oder Ideologiegemeinschaft hat vielfältige Nachteile. Der Dissident wird gemieden. Er ist in Gefahr. Im katholischen Polen des 18. Jahrhunderts war er in Gefahr, geköpft zu werden. Und noch davor wurden in ganz Europa Ketzer eifrig verbrannt.
Der Selektionsvorteil des Konformismus liegt somit auf der Hand, auch heute noch. Das Bekenntnis die herrschende Lehre zu glauben, auch, und gerade wenn sie noch so absurd ist, hilft beim Überleben und sich Vermehren in einer Gruppe.
Zu fragen wäre auch in die entgegengesetzte Richtung, ob denn der Dissens, der Widerspruch zur herrschenden Ideologie, die Verweigerung von Bekenntnissen der Dazugehörigkeit, ebenso und auf verschiedene Weise Selektionsvorteile bieten.
Das mag bei der Gruppenselektion dann so sein, wenn der Dissens in einer Gemeinschaft von verschworenen „Ungläubigen“ und „Widerständlern“ gelebt wird. Dann übernimmt der Glaube an den Dissens die Rolle der Gemeinschaftsstiftung. Der enorme und noch stärkere Gruppenzwang von Protest- und Widerstandsgruppen ist auf diese Weise eine alternative Gemeinschaftsstiftung und verhilft so zu einem Selektonsvorteil in der Gruppe, nur eben in einer oppositionellen Gruppe. Wenn dann die Dissidentengruppe auch noch im Laufe der Zeit zur neuen herrschenden Richtung wird, hat man auf das richtige Pferd gesetzt. Der Dissens wird zum Konsens, zum Mainstream. Die Ideologie der Revolutionäre wird zum Glauben der herrschenden Gewalten. Für das Bekenntnis zu dieser Glaubensrichtung gilt das oben gesagte.
Das Bekenntnis der Zugehörigkeit hat um so mehr Wert, je absurder der vorgebliche Inhalt ist. Je irrationaler die Behauptungen der Glaubensbekenntnisse, desto nachdrücklicher wirken sie als Konformitätsaussagen, als Versicherungen darüber, dabei zu sein, mit zu machen, dazu zu gehören. Dieser Wert der Konformitätsaussage ist größer bei absurden, irrationalen Inhalten, die sich empirisch, rational in keinster Weise nachvollziehen lassen. Es ist ein Zeichen dafür, wie viel einem die Zugehörigkeit wert ist, es ist der „Mitgliedsbeitrag“ als teilweiser Verzicht auf Rationalität, als Fürwahrhalten völlig unzureichend bewiesener Aussagen. Hinzu kommt bei der Gruppenzugehörigkeit noch der Beitrag an Geld, Arbeitskraft, Zeit, menschlicher Zuwendung, Lernen und Weitergeben der ideologischen Reden und Erzählungen … Es wird so der handfeste Beweis geliefert wie viel einem die Zugehörigkeit wert ist, welchen Preis, auch an Rationalität, man zu zahlen bereit ist.
Ich habe über diesen religionsphilosophischen Zusammenhang noch nirgendwo gelesen. Tertullians Satz, „Certum est, quia impossibile“, der später als „Credo quia absurdum“ kolportiert wird, nennt den Glauben an das Widersinnige, das Absurde, bezeichnet aber nicht die Funktion der Gemeinschaftstiftung gerade durch widersinnige Glaubenssätze („Certum est, quia impossibile“ – „Es ist gewiss, weil unmöglich“ „Credo quia absurdum“ – „Ich glaube weil es widersinnig ist“). Auch die Abgrenzung gegen andere Gruppen dürfte mit widersinnigen Dogmen besser gelingen. Common sense, das allgemein Akzeptierte und unmittelbar Einsichtige, das überall als bewiesen Geltende, taugt nicht zur Gruppenbildung und Abgrenzung gegen die „Ungläubigen“.
malstifte auf holz
malstifte auf holz 1:

malstifte auf holz 2:

unterhaltend
Unterhaltend zu sein ist an sich nicht schlecht. Shakespeare oder Homer sind unterhaltend, Lewis Carroll oder Gilbert Keith Chesterton sind es ebenso.
Aber man kann auch so unterhaltend sein wie die Werbepausen im Fernsehen oder wie TV-Entertainer.
grenzen
Was sind die Grenzen des Wissens? Was wissen wir und was wissen wir nicht?
Die Metapher der Grenze scheint irreführend, denn eine exakte Linie ist nicht auszumachen bis zu der wir alles genau wissen und über die hinaus wir gar nichts mehr erkennen.
Die Übergände sind eher graduell mit Rissen, Sprüngen und mehr oder weniger starken Verläufen und Unschärfen, eher wie eine unsichere Moorlandschaft im Nebel der Morgendämmerung. Und das zudem auch mit zeitlich wechselnd schnellen Änderungen, sodass, wo neulich noch fester Tritt war, bald darauf kein Halt mehr ist und einer rettungslos versinkt.
not
Wirkliche Not ist meiner Generation unbekannt. Aber die Literatur, Solschenizyn, Tolstoi, Dostojewski, von Grimmelshausen und andere, haben Not, Hunger, Flucht und Vertreibung eindringlich erzählt. Ich habe dadurch eine Vorstellung davon, was einem hier droht, wenn auch keine wirkliche Erfahrung.
Hinzu kommen die Erzählungen der Elterngeneration, auch der Großeltern, von Inflation, von Krieg, Zerstörung, Währungsvernichtung, Gefangenschaft, Vertreibung, Hunger, Kälte, Krankheit. Die Not war erlebt und teilweise unerträglich. Die Not wurde auch nicht von allen überlebt.
Sollten jetzt wieder skrupellose Finanzjongleure die Menschen, unsere Familien, in Not reißen? Ohne zur Verantwortung gezogen zu werden? Ohne Rechenschaft geben zu müssen? Ohne Wiedergutmachung, Entschädigung leisten zu müssen?
Und noch wichtiger ist die Frage, wie kann man die Not verhindern oder doch teils abwenden? Und was lernen wir, was müssen wir für die Zukunft lernen?
welt und scheinwelt
Das Fernsehen, Filme, Unterhaltungsliteratur bauen eine Scheinwelt auf, in die sich das Publikum flüchten kann. Das ist gefährlich, denn diese Scheinwelt verhindert das Verständnis der wirklichen Welt. Die Realitätsflucht erschwert das Bestehen in der Realität.
Fähigkeiten verkümmern, die in einer Fernsehwelt nicht geübt werden. Kinder werden unsportlich, besitzen weniger räumliche Koordination, die Sprachkompetenz nimmt ab und die Fähigkeit zum Zwischenmenschlichen ist schwächer entwickelt.
Kurz, diese Scheinwelten machen dumm, dick, lebensuntüchtig und führen zu weniger Nachkommen. Die Scheinwelten mutieren ihre Opfer zu evolutionären Blindgängern.
Information, Kunst ist dann gut, wenn sie das Verständnis unserer wirklichen Lebenswelt stärkt. Evolutionsbiologisch gesehen, ist die Darstellung von Welt oder von Phantasiewelten dann gut, wenn sie zu Erhalt, Wachstum und Vermehrung führt.
Frank Schirrmacher ist u.a. ein Prophet dieses Themas.
dreieck
dreieck:

filz ohne fett
filz ohne fett:

religion
Die wahre Religion, man höre und staune, denn jetzt kommt die letztgültige Klärung des lange in blutigsten Kämpfen ausgefochtenen Streits, die wahre Religion ist schlicht unser Leben im Universum. Wir können aus diesem Leben nicht austreten, wie aus einer Kirche, und ein anderes führen. Die wahre Religion ist unmittelbar unser Leben, verständig oder unverständig, voll Bewunderung für das Weltall oder abgestumpft.
Was sich als konkrete Religion in Messen, Riten, Lebensregeln … manifestiert, ist demgegenüber sehr abgeleitet, oft sehr beschränkt, fanatisch, besserwisserisch und manchmal auch lächerlich.
kugel
kugel:

systemvergleich
Ein beliebtes Spiel der Schulen in den 70er Jahren war der Systemvergleich zwischen West und Ost. (Ich war in dieser Zeit Gymnasiast in Marktheidenfeld, Bayern.) Auf der einen Seite stand die freie Marktwirtschaft, auf der anderen die zentrale Verwaltungswirtschaft. Je nach politischer Vorliebe der Lehrer fiel das Ergebnis aus. Die Lehrpläne und offiziellen Unterrichtsmaterialien wiesen, vermutlich zurecht, eine deutliche Überlegenheit der freien Marktwirtschaften nach.
Werden eigentlich auch heute noch in den Schulen oder Medien Systemvergleiche angestellt? Wird China mit den USA oder Russland verglichen? Oder wird das marktwirtschaftliche mit dem planwirtschaftlichen Russland verglichen?
Oder vergleicht man lieber erst gar nicht? Und wenn verglichen wird, geschieht das differenziert? Und was kann man daraus lernen?
hand
hand:

magische orte
Es gibt magische Orte, Orte mit denen ich verbunden bin. Es sind vielfach auch Landschaften meiner Jugend. Aber auch Stellen aus meinem späteren Leben, die etwas Geheimnisvolles und tief Verwurzelndes haben. Es sind Räume und freie Gegenden, aber es sind Lokalitäten viel eingegrenzter als das, was mit Heimat bezeichent werden könnte. Und die Dauer der Magie ist groß, eigentlich endlos.
Die magischen Orte geben dem, der sie spürt, Kraft, körperlich und geistig.
Nur um Misverständnissen vorzubeugen, es sind keine Orte eines religiösen Kultes oder religiöser Erfahrung. Vielmehr bin ich überzeugt, dass mit Fortschritt der Wissenschaften eine naturalistische Erklärung gefunden werden wird. Bis dahin sind die Orte geheimnisvoll wirksam, einfach so!
gut
Es geht um Moral, um Begründung von Moral, also Ethik.
Wenn etwas unmittelbar angenehm ist, sind moralische Regeln nicht nötig.
Erst wenn die nahe liegende Handlung unangenehm ist, oder schwierig, mühsam, schmerzhaft, anstrengend usw., dann wird eine moralische Regel erforderlich. Diese Regel bewirkt im Allgemeinen, dass die unangenehme Handlung in Kauf genommen wird für ein höheres Gut, das mit ihr verbunden ist. Eine Unangenehme Handlung alleine für sich, ohne ein daraus folgendes Gut, ist moralisch nicht erstrebenswert. So ist auch „Leiden“ oder ein „Opfer“ ohne ein daraus erwachsendes höheres Gut sinnlos und verwerflich.
Es wird allerdings, durchaus und insbesondere in religiösen Systemen, ein „Opfer“ ohne Rücksicht auf ein höherwertiges Gut gefordert. Das ist vor allem dann hinterhältig, wenn die eigentlichen Profiteure der pseudomoralischen Handlung nicht genannt werden möchten. So wird man Opfer oder Leiden an sich für gut erklären, ohne das dadurch bewirkte Gut zu bedenken, wenn eine Pristerkaste oder irgendeine andere herrschende Gruppe davon profitieren, aber als Profiteure nicht klar erkannt werden wollen, meist aus Furcht vor berechtigter Rebellion.
Die moralische Handlung ist, ökonomisch formuliert, der Preis für den moralischen Gewinn.
Das Gut ist weiter weg als die moralische Tat. Diese Entfernung kann zeitlich sein. Zunächst muss man als Schüler fleißig lernen, dann bekommt man gute Noten, einen guten Abschluss und den gewünschten Beruf. Der zeitliche Horizont in diesem Beispiel erstreckt sich über viele Jahre.
Die Entfernung kann auch ein Nutzen für andere Menschen sein, die einem nicht so nahe sind, wie man selbst oder der engere Kreis der Familie, der Kollegen usw.. Z. B. verzichtet man auf das Ausgeben einer Summe und spendet das Geld für notleidende Menschen in einem fremden Land.
Man sieht, das Gut ist weiter weg, ist entfernter, als die moralische Handlung. Die Unannehmlichkeit ist näher, als der Gewinn. Das macht moralische Regeln überhaupt erst nötig und das macht die Befolgung moralischer Regeln auch häufig schwierig und führt letztlich nicht selten zur Missachtung der Regel, der unangenehmen Pflicht.
Wenn Last und Nutzen bei derselben Person liegen, ist die Sache einfacher. Die Ernte wird lediglich später eingefahren.
Komplexer ist es, wenn die Mühen bei dem Einen liegen, der Gewinn aber bei einem Anderen. Der, der die Beschwerlichkeiten hat, fährt nicht die Ernte ein. In der Erwerbswelt sieht es dann so aus, dass der eine die Arbeit hat und der andere den Ertrag der Arbeit genießt. Das ist der Fall schon bei einer schlichten Geldspende. Der Geber muss in der Regel für das Geld arbeiten, der Empfänger hat den Nutzen, den Ertrag der Arbeit. Wenn man jemandem selbst verdientes Geld schenkt oder spendet, arbeitet man mittelbar für ihn.
Die Frage in solchen Fällen ist, wem nützt diese moralische Regel? Cui bono?
Evolutionsbiologisch ist Moral, die nicht direkt die eigenen Gene fördert, von fraglichem Wert. Hier ist es aber auch entscheidend, wie die Einheit bestimmt wird, die einer Selektion unterliegt. Sind es nur Individuen und deren Erbgut (Gene), so ist altruistisches Verhalten gegen nicht verwandte Menschen schwer zu erklären. Sind es größere Menschengruppen und gesamte Naturzusammenhänge (z.B. das globale Ökosystem), die durch Moral einen Vorteil haben, so werden entsprechende Regeln eher verständlich und begründbar.
Von der moralischen Regel, die eine Person befolgt, profitiert ein größerer Zusammenhang, eine größere Einheit, deren Mitglied das moralische Individuum ist. Wer lediglich die Person, das Individuum und sein Genom als Einheit der Selektion betrachtet, kommt zu einer egoistischen Moral. Wer, wie der Autor, Selektion auf verschiedenen Ebenen betrachtet, kann den Vorteil moralischer Regeln für nicht egoistisches Verhalten gut erklären und evolutionsbiologisch begründen. So nutzen beispielsweise Familien, Stämme, Landsmannschaften, Nationen und transnationale Verbände bis hin zur gesamten Menschheit moralische Regeln.
delfine
delfine im schwarm:

delfine aus der nähe:

alt
Alter und das Alte gelten in den Massenmedien eher als schlecht. Jugendlichkeit ist höher im Kurs. Gegen das Altern soll Antiaging helfen, selbst wenn der Schuss in mehrfacher Weise nach hinten los geht. Auch die Warenwelt liebt das Neue, den Wechsel der Moden, die „Innovation“, um den Absatz der Güter zu fördern und immer weiter zu steigern.
Doch das Alte ist auch das Bewährte. Etwas das lange Bestand hat ist solide, gut gebaut, fest und widerstandsfähig. Das könnte man so ungefähr von alten Schuhen, ja auch von alten Menschen, oder von alten Moralvorstellungen sagen.
Die Dignität des Alten ist nicht zu unterschätzen.
In Religion oder Philosophie ist der Bezug auf Vorvormaliges nicht selten. Luther geht auf die Bibel zurück (ad fontes), Heidegger auf die Vorsokratiker.
Künstlich wird der Anschein hohen Alters erzeugt. Ein Beispiel gibt Martin Walser von einem Herren, der seine Anzugstoffe durch Lagerung in der Sonne ausbleichen lässt. Thomas Bernhard schreibt von dem Renomieren des Adels mit ältesten Lodenkleidungen. Unter 100 Jahren wäre es gar nichts wert. Auch für die Ahnentafel gilt, je länger, desto besser, am besten bis ins Neolithikum.
Die kleine Renaissance des alten, lateinischen Ritus in der katholischen Kirche ist ein ebensolches Stück Würde des Alten. Martin Mosebach schreibt hierüber.
Die Theologie geht über das Alte auf das schon immer Gewesene, das Ewige hinaus.
gefaltet, gezeichnet und glasiert
gefaltet, gezeichnet und glasiert:

plastik
plastik:

geld
Ein paar Redensarten und zwei Kurzanekdoten zur gegenwärtigen Finanzkrise und möglicherweise beginnenden Wirtschaftskrise:
- Pulver trocken halten.
- Spare beizeiten, dann hast du in der Not.
- Die Anektodote las ich bei Max Otte: Familie Wehrhahn musste nach langem Hinauszögern doch endlich die stark abgenutzte Holztreppe der Villa renovieren. Das Familienoberhaupt hatte die rettende Idee: man würde einfach die Holzstufen umdrehen. Gesagt, getan; doch als die erste Stufe umgedreht wurde, stellte man fest, dass ein Vorfahre bereits die gleiche Idee gehabt hatte. Darauf der Hausherr in rheinischem Dialekt: „Wir haben es eben nicht vom ausgeben, sondern vom behalten.“
- Joseph Abs wurde einmal gefragt: „Herr Abs, was würden Sie tun, wenn sie eine Million Mark hätten?“ Ohne lange zu überlegen sagte Abs: „Da müsste ich mich schon sehr einschränken.“
wert
Was erzeugt wirtschaftlichen Wert, anders formuliert, wie entsteht wirtschaftlicher Reichtum?
Für den Einzelnen stellt sich die Frage, wie werde ich reich? Eine nicht uninteressante Frage. Wie werden Gruppen, z.B. Familien, Betriebe, Unternehmen, Länder, Nationen oder ganze Erdteile reich oder zumindest wohlhabend. Und was begründet diesen Reichtum, diesen wirtschaftlichen Wert?
Eine mögliche Antwort liegt in der produktiven Arbeit. Hinzu kommt die erfinderische, kreative Arbeit. Dann noch natürliche Resourcen, wie Klima, Boden, Rohstoffe, Luft, Licht …
Aber im Wesentlichen ist es die Arbeit, die Reichtum schafft.
Nun sollte man auch den Genuss des Reichtums nicht von der Arbeit trennen. Ich spreche von arbeitslosen Einkommen, auch der sehr Vermögenden, die „von ihrem Vermögen leben“, aber auch von den Empfängern von Hilfe.
Diese Hilfe sollte m. E. auch sein. Aber auf der anderen Seite muss man die, die Hilfe empfangen, auch zur möglichen Tätigkeit im Gemeinwesen anhalten. Es darf nicht nur genommen werden, sondern der, der erhält, soll nach seinen Möglichkeiten auch geben. Das ist er der eigenen Ehre schuldig und denen, die ihm helfen.
Spekulanten und Rentiers sollten von der Gemeinschaft auf das beschränkt sein, was sie selbst erarbeiten.
Ja auch in Gefängnissen sollte man selbst für seinen Unterhalt einschließlich der Gefängnismauer aufkommen. Auch Gefangene sollte hart arbeiten und nicht auf Kosten der Steuerzahler leben.
belastungsprobe
Bundeswirtschaftminister Micheal Glos erwartet als Folge der Finanzkrise eine „Belastungsprobe für Deutschland“.
Belastungsproben und Proben überhaupt sind auch immer eine Chance Kräfte zu sammeln und zu beweisen. Das kann durchaus ein allgemeines Ärmel hochkrämpeln und zusammen halten geben.
Wichtig ist die geistige und körperliche Stärkung.
Für vermeidbare körperliche Schwächungen darf kein Platz sein. Rauchen, Drogen, Alkohol, Übergewicht, unnötige Risiken müssen beseitigt werden, schnell und entschieden.
Die geistige Stärkung in allen Lebensaltern ist noch entscheidender. Bildung in den zentralen Bereichen, Fertigkeiten, die die Produktivität steigern und erfinderische Kreativität müssen ganz andere Dimensionen erreichen. TV und weitere Gelegenheiten zur Verblödung sind untragbar, ein Luxus, den wir uns nicht mehr leisten können.
Zudem benötigt Deutschland eine ausgezeichnete militärische Landesverteidigung.
bildung nicht geheim
Vorlesungen sollten als Videos ins Internet, weitere Unterlagen ebenso.
Das würde der Qualitätssicherung dienen und dem Lernen nicht nur der Studenten.
Das Massachusetts Institute of Technology macht seit 2001 nach und nach alle Kursunterlagen über das Internet öffentlich zugänglich. [+ MITOPENCOURSEWARE. Unlocking Knowledge, Empowering Minds.]
Warum tut das nicht auch die Uni Würzburg oder Ulm, beispielsweise?
Nur ein nettes Beispiel des MIT: HST.512 Genomic Medicine
beschränkung
Calorie restriktion, zu Deutsch Kalorienrestriktion oder -beschränkung, ist eine hoch effiziente Strategie gegen alterskorrelierte Erkrankungen und in vielen Tierarten eine Strategie gegen das Altern selbst.
Ich kann mir aber auch durch andere Beschränkungen günstige Effekte vorstellen:
- calorie restriction
- financial restriction
- moral restriction
- sexual restriction
- ästhetic restriction
- literary restriction
- …
Beschränkungen sind ein Gewinn. Sie formen. Das Negative und weniger Gelungene wird entfernt, das Übermaß ebenso.
wer löffelt die suppe aus?
Im Krankheitsfall zahlen die Versicherungen. Die Beiträge auch der Gesunden helfen den Kranken. Die Gesunden zahlen für die Kranken mit.
Das ist verständlich, wenn die Krankheit schicksalhaft eintritt. Das mag durch Unfall sein oder durch Zufall oder durch eine unglückliche genetische Veranlagung usw..
Was aber, wenn die Krankheit durch das Verhalten des Kranken verursacht ist, was wenn der Kranke selbst für die Erkrankung verantwortlich ist?
Wer Ski fährt und sich dabei verletzt, kann die gesetzliche Krankenversicherung in Anspruch nehmen. Wer raucht und dadurch erkrankt, nimmt die Nichtraucher über die Krankenversicherung mit in die Pflicht. Wer Übergewicht hat und sich nicht ausreichend bewegt, belastet finanziell auch die, die Vorsorge betreiben.
arbeit und wohlstand
Arbeit in Produktion oder Dienstleistung schafft Wohlstand und Reichtum. Aber kommen die, die die Arbeit leisten, auch in den Genuss des Reichtums?
Ein Zitat aus der Wirtschaftwoche zeigt wer genießt:
„Die massive Kredithebelung hat massiven Wohlstand geschaffen, und das ist vorbei“, sagt Orin Kramer, Partner beim Hedgefonds Boston Provident. [www.wiwo.de Angeschlagene Hedgefonds treiben Dax-Kurse. 20.9.08]“
So, jetzt wissen wir es. Die „massive Kredithebelung“ hat den Wohlstand geschaffen und nicht die Arbeit der werktätigen Bevölkerung. Oder ist es so, dass die „Kredithebler“ sich die Früchte der Arbeit mit Hebeln angeeignet haben?
am kreuz, weihnachtlich
der weg zur endlosigkeit. wer augen hat, …

marsmenschen
wie sehen lebewesen von anderen planeten aus?

rettungsfahrzeug
eine äußerst zuverlässige version:

ordentlich
Wer äußerlich den Gepflogenheiten entspricht, vermittelt auch auf anderen Ebenen den Eindruck der Konformität, der Regelbefolgung. Die dem Anlass entsprechende Garderobe und noch mehr das ordentliche Verhalten lassen einen auch im Inneren korrekten Menschen erwarten. Umgekehrt geben äußerliche Regelbrüche die Anmutung auch einer größeren inneren Freiheit von Konventionen.
Aber wie sehr hier Täuschungen möglich sind, ist bekannt, und das bierernste Übernehmen von Gruppenzwängen, von corporate identities, von Konvent, lässt schmunzeln und ein simples Gemüt vermuten, das sich gewitzt fühlt.
ein rechner [sehr komplexe schaltkreise]
ein rechner:

erbgut
Führt die Medizin dazu, dass sich Menschen mit genetisch bedingten Krankheiten häufiger und zahlreicher fortpflanzen?
Diese Frage ist sicherlich nicht politisch korrekt. Ich vermute, dass sie bejaht werden muss. Allerdings würde ich mich nur auf gute wissenschaftliche Untersuchungen zur Beantwortung dieser Frage einlassen.
Und durch die gestellte Frage ist noch Nichts über die Konsequenzen gesagt, die man bei einer Verschlechterung des Erbgutes in einer Population ziehen würde. Eine vermeindliche Verschlechterung kann im Sinne der genetischen Diversität bei veränderten Selektionsbedingungen zum Vorteil werden.
Dennoch bleibt der von Platon in der Politeia angeführte Grund, dass durch Heilkunst Kranke zur Fortpflanzung kommen und so ihre Schwäche, ihre Neigung zur Krankheit und bisweilen auch den Krankheitserreger an die nächste Generation weitergeben.
Hätten diese Kranken nicht die Möglichkeiten der Heilkunst und würden sich demzufolge weniger oder gar nicht vermehren, wären die folgenden Generationen gesünder.
Führt also Medizin bei den kommenden Generationen zu mehr Krankheit und Leid? Erkauft man durch kurzfristige Hilfe langfristige Schäden an kommenden Generationen? Verstößt hier die Heilkunst gegen den hippokratischen Eid? Schadet sie mehr als sie nützt?
motorsäge
motorsäge aus kontrolliert biologischem anbau:

am besten
Wenn etwas getan wird, dann so gut wie unter den gegebenen zeitlichen, finanziellen, menschlichen Bedingungen möglich.
Das schuldet man den Mitmenschen und sich selbst.
ausdruck
Gedanken, formuliert, in Worte gefasst, durch innerliche, stumme Rede ausgedrückt, werden deutlicher. Die Deutlichkeit zeigt, wie gut formuliert wurde. Ein klarer, kurzer, nüchterner Stil formt das Denken.
Aufschreiben ist noch besser. Platon sah das zwar anders. Aber das Herausbringen, das Objektivieren oder „das Herausgeben“ spiegelt die Gedanken, reflektiert.
Wer zumindest vor möglichen Lesern schreibt, ist noch strenger, nimmt sich in der Öffentlichkeit mehr zusammen.
Wie wichtig ist die Sprachform, wie wichtig ist der gute, schöne Stil? Oder sind es eine schöne Frisur, schöne Schuhe und Kleider und polierte Fingernägel? In was steckt einer mehr Zeit, Geld und Mühen?

innen, außen
Äußerlichkeiten werden in der Absicht gepflegt einen günstigeren Eindruck auch vom Inneren zu geben. So hilft schöne Kleidung über den nicht ganz so attraktiven Körper hinweg und Zeichen des Wohlstandes, Statussymbole, sollen den Eindruck von Vermögen erzeugen, das so nicht vorhanden ist. Gefärbte Haare, geliftete Haut, vorzugsweise im Gesicht, vermitteln Jugendlichkeit, wenn diese innerlich schwindet.
All diese Bemühungen sind kontraproduktiv, wenn, und das ist oft der Fall, die Diskrepanz zwischen Innen und Außen bemerkt wird. Der auf jung getrimmte ältere Mensch wirkt absurd und lenkt durch seine vergeblichen Bemühungen die Aufmerksamkeit gerade auf sein Alter. Der beruflich nicht Erfolgreiche macht durch ostentative Symbole des materiellen Erfolges auf das mitunter Verzweifelte seiner Lage noch mehr aufmerksam.
Zudem zeigt der äußerlich bemühte Mensch, dass er sein Inneres, das er zu verbergen sucht und über das er täuschen möchte, nicht für angemessen und wertvoll hält. Der Blender hat ein schlechtes Selbstwertgefühl.
Und dann kommt noch die Angst vor der Entdeckung, die unfrei macht.
Das Innere „authentisch“ nach Außen gekehrt ist nicht die richtige Alternative.
Das was nach Außen getragen wird, sei es durch Lebensführung, Kleidung und Gestaltung sollte nicht alles offenbaren müssen, sondern es sollte frei von der Absicht sein einen günstigeren Eindruck zu erwecken. Es sollte ohne Effekt sein.
Die Wirtschaft lebt gut vom schönen Schein. Die Werbung zelebriert ihn und ist damit die heilige Messe einer imaginären Welt, in der scheinbar junge, kluge, ausgeglichene, wohlhabende, schöne … Menschen leben.
Die Mengen an Zeit und Geld, die für den äußeren Anschein aufgewendet werden, sind enorm. Die Bauwirtschaft, die Modeindustrie, die Kosmetik, Autohersteller … leben zu einem hohen Anteil von der Neigung mehr zu scheinen als zu sein.
Die Gegenbewegung, weniger Schein als Sein ist sympathischer und noch entspannter ist ein ausgeglichenes, nicht aber ungefiltertes Verhältnis von dem, was ist und dem was gezeigt wird.
entfaltet
gefaltet von beiden seiten:
eine seite:

die andere seite:

und entfaltet