blau
blaues quadrat

null
blaues quadrat

null
überkorrekt – nachlässig : lässig
verkrampft – schlapp : locker
angepasst – rebellisch : selbstständig
vorlaut – duckmäuserisch : antwortend
aufgeplustert – eingesunken : aufrecht
dick – dürr : schlank
dumpf – aufgekratzt : konzentriert
egoistisch – selbstlos : goldene regel
Nicht alles folgt diesem Schema und manche dieser vorstehenden Beispiele mögen sogar etwas schief sein. Aber das Optimierungsproblem, das zwischen zwei oder noch mehr Polen eine Mischung sucht, die das beste Resultat bringt, dieses Optimierungsproblem, so nennt man es in der Mathematik, ist ein oft nützlicher Ansatz und führt über dichotomisches Denken hinaus.
Das gesundheitliche Risiko durch Bauchfett ist gut belegt.
“Abbau von Bauchfett schützt Gefäße und Stoffwechsel April 2007 – Überflüssiges Körperfett abzubauen ist die effektivste Maßnahme, um Zivilisationskrankheiten wie Diabetes Typ 2 und Herzkreislauferkrankungen vorzubeugen. Allerdings kommt es darauf an, wo die Fettpolster sitzen. Dies ist ein Ergebnis eines mehrjährigen Forschungsprojektes der Universität Tübingen, das Experten im Rahmen der 42. Jahrestagung der Deutschen Diabetes-Gesellschaft (DDG) vorstellen. Die Tagung findet vom 16. bis zum 19. Mai 2007 im CCH Hamburg statt. Präventionsprogramme sollten vor allem auf die Fettpolster im Bauchbereich zielen. Denn diese verursachen erhöhte Blutzucker- und Blutfettwerte sowie vermehrte Entzündungsvorgänge, die langfristig Herz und Stoffwechsel schädigen. An der Universität Tübingen beschäftigt sich seit einigen Jahren ein Forschungsprojekt mit der Frage, wie sich Diabetes Typ 2 und die damit zusammenhängenden Gefäßschädigungen vermeiden lassen. Mehr als 400 Personen haben an der Studie teilgenommen. Ein Ergebnis: Schon bei den sogenannten Prä-Diabetikern verursacht die beginnende Insulinresistenz Schäden an den Gefäßen. Anzeichen einer drohenden Gefäßverkalkung, der Arteriosklerose, haben die Tübinger Probanden, die besonders viel Fett am Bauch mit sich herumtragen – Experten sprechen auch von viszeralem Fett.” [http://www.deutsche-diabetes-gesellschaft.de/redaktion/pressemitteilungen/abbau_bauchfett.php]
Weniger bekannt ist wie man Bauchfett verhindert oder es wieder los wird. Das hat auch ästhetische Relevanz.
Nicht nur die einfache Kalorienreduktion mit ausreichender Nährstoffzufuhr scheint sinnvoll. Darüber hinaus zeigt sich durch neuere Forschung, dass insbesondere eine sehr mäßige Zufuhr von Eiweiß das Bauchfett minimiert und gesundheitsfördernd und lebensverlängert wirken kann.
Das Resultat wären schlankere, gesündere Menschen mit einer höheren Lebenserwartung.
Zudem käme es zu einem schöneren Anblick. Bachspeck ist nicht attraktiv.
dietary restriction = DR
maximum life span potential = MLSP
reactive oxygen species = ROS
“4. Protein and methionine restriction studies and longevity.
It has been classically believed that the effect of DR extending MLSP should be attributed to a decreased intake of calories themselves rather than to decreases in specific dietary components. However recent reports in Drosophila melanogaster challenge this general consensus [13] and changes in the main dietary components also seemto be able to modulate longevity in rodents [42] and insects [13]. Available studies do not support the possibility that either life-long carbohydrate or lipid restriction increase rodent longevity. In Fisher 344 rats, longevity did not change after lipid restriction [43,44] whereas carbohydrate restriction or supplementation studies led to contradictory and minor changes in rat longevity [45,46]. Nevertheless, the great majority of protein restriction (PR) investigations performed in rats and mice showed an increase in maximum longevity after this dietary treatment. Ten out of eleven PR studies in rats or mice (16 out of 18 different life-long survival experiments) reported increases in MLSP […] although the magnitude of the increase (around 20%) was lower than that usually found in DR (around 40%). These investigations (Table 1) suggest that PR can be responsible for 50% of the life-extension effect of DR and would be in agreement with the fact that isocaloric methionine restriction (MetR) also increases MLSP in rats and mice [47–50]. Any experimental model that increases MLSP should decrease the incidence of age-related degenerative diseases. In this line of evidence, recent studies show that MetR not only increases rodent longevity but also slows cataract development, minimizes age-related changes in T cells, lowers serum glucose, insulin, IGF-I and thyroid hormone levels, and increases resistance to oxidative liver cell injury in mice [49].MetR also decreases visceral fat mass (by 40%) and prevents age-related increases in blood triglycerides and cholesterol in rats [51], stops division of cancer cells [52] and inhibits colon carcinogenesis [53]. The strong decrease in visceral fat mass points out the possibility that such a change, characteristic of DR animals, could not be necessarily related to a lower calorie intake. (1.), [Hervorhebung Konrad Kuhmann]”
Nicht nur weniger essen, sondern vor allem weniger Eiweiß (Proteine) essen, zugleich aber ausreichende Zufuhr aller Nährstoffe, auch von Eiweiß, um Eiweißmangelerscheinungen zu vermeiden. Auch hier, wie in so vielen Dingen, ist das rechte Maß, der vernünftige Mittelweg sinnvoll. Tendenziell ist aber eine eiweißreduziertere Ernährung anzustreben. Das sind recht neue wissenschaftliche Erkenntnisse.
Merkt der Fisch im Wasser, dass er nass ist?
Womit wir räumlich und zeitlich unterschiedslos umgeben sind, fällt uns nicht auf. Wir reagieren mit unserer Wahrnehmung, mit unserem Denken, Fühlen, der Stimmung, mit unserem ganzen geistigen Apparat auf Veränderungen. Das immer Gleiche hat für unser Bewusstsein keine Bedeutung, es erfordert keine Reaktion und die Perzeption brächte keinen Selektionsvorteil in der Entwicklungsgeschichte.
Die Veränderung fällt uns auf. Das ist schon bei taktilen Reizen so. Bewegung auf der Haut, beispielsweise, wird stärker wahrgenommen, als gleichbleibender Druck. Die Veränderungen im Vermögen, plötzlicher Wohlstand oder unerwartete Armut, sind weit eher spürbar, als eine Beständigkeit der Verhältnisse.
Ebenso ist es mit dem Erstaunlichen. Es wird nicht im Alltäglichen gesehen. Das Besondere, das Großartige, das Göttliche wird im Wunder bemerkt. So erwartet die katholische Kirche noch heute bei der Heiligsprechung bewiesene Wunder.
Diese Wunder erscheinen mittlerweilen unglaubwürdig und geringfügig, verglichen mit den erstaunlichen Erkenntnissen der Naturwissenschaften. Zudem behaupten die Wunder die Strukturen (Regelmäßigkeiten, Theorien und Gesetze) der Alltagserfahrung und auch des naturwissenschaftlichen Weltbildes außer Kraft zu setzen.
Die Naturwissenschaften, die Mathematik und andere Geisteswissenschaften, die Kunst, das „Abenteuerliche“ im Leben, der Ausbruch aus dem Gewohnten und Vertrauten, das Durchbrechen der „Komfortzone“, bringen andere Sichtweisen und überschreiten die Alltagserfahrung.
Das Wunder wird in diesen Ausbrüchen über die Alltagserfahrung, über das gewohnte Einerlei hinaus glaubwürdig erfahrbar. Damit können traditionelle religiöse Wundergeschichten nicht konkurrieren. Sie verblassen, sind unglaubwürdig und abstrus.
Das Bedürfnis nach dem Außergewöhnlichen, dem Wunderbaren ist legitim und findet auf moderne Art seine Befriedigung.
[I. Kant: Kritik der praktischen Vernunft, (AA V), Seite 161]
Edward O. Wilson schreibt in seinem Buch über die Einheit des Wissens, dass die Erkenntnisse der naturwissenschaftlichen Forschung endlos mehr Grandeur besitzen, als die Wundergeschichten der Religionen. Ich glaube er benutzte dieses Wort „Grandeur“, leider finde ich gerade das Buch und die Stelle nicht – wieder ein guter Grund für digitale Bücher, am besten in der Wissenswolke, der cloud.
In der Tat ist der Unterschied naturwissenschaftlicher Erkenntnisse zu unserer Alltagserfahrung noch viel gewaltiger, als wenn Jesus Christus Blinde sehen macht, über Wasser geht, oder Lahme zum Laufen bringt. Den Wesentlichen Punkt des Wunderbaren, den Unterschied zum Gewohnten, beschreibt Wilson nicht. Auch nicht den Wunsch und den Grund des Bedürfnisses der Menschen nach dem Erhabenen, dem Außergewöhnlichen und Göttlichen.
blumen

wildes rot

Ruhe und Konzentration sind Bedingungen für die Arbeit. Und die Ruhe ist auch Abstand von Lärm und Gerede, von Geselligkeit, vom An- und Aufeinanderhängen der Gesellschaft.
Thomas Bernhard:
„“Um mich ausleben zu können, wie ich will, bleibt mir nichts anderes übrig als das Alleinsein. Es ist eben so, dass mich Nähe tötet. Aber ich bin deshalb nicht zu bedauern.“
Die völlige Isolation hilft nicht. Sprache, Gesichter, der Austausch sind nötig, nur der Lärm, die Zerstreuung, der Unsinn und das zu eng und zu dicht und zu lange Aufeinander fallen lästig. Es ist nicht die Gesellschaft der Anderen, sondern der Mangel an Distanz, an Rücksichtnahme, an Höflichkeit. Es ist das Laute, Bunte, Schrille und der sinnlose Kampf gegen die Langeweile.
nummer 1:

nummer 2:

Nähe und Distanz. Schopenhauers Fabel von den Stachelschweinen ist anschaulich. Die Schweine rücken zusammen um sich zu wärmen, gemütlich wollen sie es haben. Doch dann, bei zu engen Berührungen, werden die Stacheln fühlbar.
„Eine Gesellschaft Stachelschweine drängte sich en einem kalten Winterrage recht nah zusammen, um sich durch die gegenseitige Wärme vor dem Erfrieren zu schützen. Jedoch bald empfanden sie die gegenseitigen Stacheln, welches sie dann wieder von einander entfernte. Wann nun das Bedürfnis der Erwärmung sie wieder näher zusammenbrachte, wiederholte sich jenes zweite Übel, so da? sie zwischen beiden Leiden hin und her geworfen wurden, bis sie eine mäßige Entfernung voneinander herausgefunden hatten, in der sie es am besten aushalten konnten.
So treibt das Bedürfnis der Gesellschaft, aus der Leere und Monotonie des eigenen Innern entsprungen, die Menschen zueinander; aber ihre vielen widerwärtigen Eigenschaften und unerträglichen Fehler stoßen sie wieder voneinander ab. Die mittlere Entfernung, die sie endlich herausfinden, und bei welcher ein Beisammensein bestehen kann, ist die Höflichkeit und feine Sitte. Dem, der sich nicht in dieser Entfernung hält, ruft man in England zu: keep your distance! – Vermöge derselben wird zwar das Bedürfnis gegenseitiger Erwärmung nur unvollkommen befriedigt, dafür aber der Stich der Stacheln nicht empfunden.
Wer jedoch viel eigene, innere Wärme hat, bleibt lieber aus der Gesellschaft weg, um keine Beschwerde zu geben, noch zu empfangen.“
Es kann aber auch der Rang entscheiden über den sozialen Abstand, nicht nur die „innere Wärme“. Eine positive Korrelation besteht. Das ist stärker bei wirklichem Rang als bei formalem. Das Pathos der Distanz ist auch eine Frage darüber, was die Menschen unterscheidet und was sie gemeinsam teilen. Es ist eine Frage von der Auffassung des Zusammenlebens in einer Kultur und des Zusammenlebens der Kulturen. In wie weit sind alle gleich, wo bestehen Unterschiede und was ist besser oder schlechter. Hierhin gehören auch Dünkel, vornehm tun und Symbole, Zeichen eines Ranges, der oft nicht besteht.
Was ist Freiheit?
Freiheit gibt es nur im Bezug auf die Zukunft. Und Freiheit gibt es allein als Wahlmöglichkeit in Gedanken, die auf die Zukunft gerichtet sind. Im Bezug auf die Wirklichkeit gibt es nur eine Variante. Zumindest in unserer Alltagserfahrung existiert nur eine Welt gestern und heute. Für die Zukunft können wir uns mehrere Möglichkeiten, mehrer Entscheidungsmöglichkeiten vorstellen. Wirklich kann dann auch nur eine Möglichkeit werden in der gegenwärtigen und vergangenen Realität.
Noch einmal zur Klärung des vielgeschundenen und missbrauchten Begriffs Freiheit: Freiheit ist eine vorgestellte Wahlmöglichkeit für die Zukunft. Freiheit gibt es nur im geistigen Bezug auf Zukünftiges und hier nur dann, wenn Entscheidungsmöglichkeiten antizipiert werden können. Wenn bewusst ist, dass man keine Wahl haben wird, hat man auch in der Vorstellung von der Zukunft keine Freiheit.
Damit ist das Problem von Freiheit und Determinismus gelöst. Determinismus besteht für die Gegenwart und Vergangenheit. Determinismus heißt ja nur, die Sache ist entschieden (determinare).
Freiheit besteht für die vorgestellten, in Gedanken durchgespielten, für die geistigen Wahlmöglichkeiten bezüglich der Zukunft. Eine sehr alte Frage ist hiermit geklärt. Das hat auch Bedeutung für das praktische Handeln, im engeren Sinne für die Politik.
Leben und Sterben sind erfahrbar. Auch im Sterben lebt der Mensch noch. Er ist auf dem Weg zum Tod. Mit dem Tod endet das Leben. Damit endet auch das Erleben, die Erfahrung. Der Tod ist für den, der Tod ist, nicht mehr erfahrbar. Der Tod anderer Menschen ist natürlich erfahrbar, weil der, der die Erfahrung des Todes von Anderen machen kann, selbst notwendig leben muss. Tod ist nur erfahrbar als der Tod Anderer, nicht als der eigene Tod.
Der eigene Tod ist sprachlich nicht fassbar. Er ist nicht Nichts. Nichts macht nur Sinn im Bezug auf „Etwas“, als allgemeinstes ontologisches Substrat. Der Tod ist jenseits sprachlicher Beschreibbarkeit. Nur der Hinweis auf seine Unaussprechlichkeit macht ihn sprachlich indirekt fassbar. Das allerdings auch nur so, dass er als unfassbar bezeichnet wird.
Die Mythen über den Tod, z. B. über Wallhalla, über das Fegefeuer, den Himmel und die Hölle, über die ewigen Jagdgründe sagen nichts über den Tod. Sie sagen deshalb nicht etwas Unsinniges. Diese Geschichten, die es in allen Kulturen gibt, sagen Wichtiges nicht über den Tod, sondern über das Leben. Es sind Wunschträume, Sehnsüchte, Phantasien, kunstvolle und allen Respekt verdiende Mythen der jeweiligen Kultur. Sie prägen das Selbstverständnis der Menschen, die an die Geschichten glauben und sie tradieren, weitertragen von Generation zu Generation und sie über ihre eigene Kultur hinaus der restlichen Menschheit mitteilen.
Irgendwo hat Wittgenstein geschrieben, dass der Tod kein Ereignis des Lebens sei. Ich finde leider die Stelle nicht mehr, aber sie dient mir als Kristallisationspunkt.
Ach ja, ich hab jetzt die Stelle gefunden:
„Der Tod ist kein Ereignis des Lebens. Den Tod erlebt man nicht.“
[Ludwig Wittgenstein. Logisch-Philosophische Abhandlung, Wilhelm Ostwald (ed.), Annalen der Naturphilosophie, 14 (1921) 6.4311]
Vielleicht ist es zu naiv. Aber ich glaube, dass es im Wirtschaftsleben eine einfache Zweiteilung, eine schlichte Dichotomie gibt. Die einen Arbeiten produktiv, die anderen arbeiten nicht oder zumindest nicht produktiv und leben von der Arbeit der Tätigen.
Irgendjemand muss das Getreide sähen, das Holz fällen, den Fisch fangen, die Kinder erziehen und unterrichten, das Essen kochen, die Autos konstruieren und die Supercomputer zusammenbauen. Irgendjemand muss die Straßen bauen und die Toiletten putzen, den Blinddarm operieren und die Zähne bohren. Ich hatte schon immer den größten Respekt vor produktiv tätigen Menschen, vor Menschen die Dienste verrichten, durch die andere einen Nutzen haben.
Es gibt aber dann auch noch genug und, wie ich meine, viel zu viele, die nichts Produktives leisten. Sie leben mehr oder weniger geschickt von der Arbeit anderer. Z.T. leben sie von sozialen Transferleistungen, teilweise sind sie aber auch sehr vermögend und „lassen ihr Geld für sich arbeiten“. Ich habe allerdings noch kein Geld gesehen, das Straßen kehrt oder Transistoren lötet. Das waren, soweit meine Beobachtungen gehen, immer Menschen.
Der Großteil der nicht Produktiven findet sich aber dort, wo das Fell des Bären, den andere gejagt und erlegt haben, verteilt wird. Ich möchte hier nicht deutlicher werden. Diese Menschen haben bisweilen außerordentliche Macht und beste Beziehungen.
Noch einmal, mein Respekt gilt denen, die wertvolle Produkte herstellen und Dienstleistungen verrichten. Meine Hochachtung gilt im weiteren Sinne den Arbeitern.
feuerwehr

Ist Moral überhaupt notwendig oder kommt man besser ohne sie aus. Nietzsche erklärt die Überflüssigkeit und Schädlichkeit zumindest der Sklavenmoral wortgewaltig in mehreren Schriften und Aphorismen.
Moralische Grundsätze und Regeln, Maximen und moralische Traditionen und Gepflogenheiten sind erst dann nötig, wenn etwas erwünscht ist, aber zugleich mit Unannehmlichkeiten verbunden wird.
Für Dinge, die ohne Weiteres angenehm sind, braucht man keine moralischen Regeln. Nur das Unangenehme, das aufgrund eines angestrebten höheren Gutes erforderlich ist, nur dieser unangenehme Zustand, die lästige und beschwerliche Handlung, die anstrengende Haltung, benötigt die Moral. Wir sollen etwas tun was wir von alleine, ohne den moralischen Grundsatz, nicht tun würden.
Gerechtfertigt ist die Anstrengung, die Mühsal der moralischen Handlung durch den aus ihr zugleich folgenden höherwertigen Effekt. Das Gut, das durch die moralische Handlung erreicht wird, sollte die Mühen und Leiden deutlich überragen. Es sollte entscheidend größer sein als die Beschwernis der moralischen Haltung.
Interessant wird es, wenn Last und Gewinn einer moralischen Handlung auf verschiedene Personen verteilt sind. Dann hat einer die Mühe, der andere den Genuss. Man sollte also fragen, bei wem der Nutzen der moralischen Handlung liegt und wer die Kosten und Mühen, die Beschwernisse und Leiden trägt. Zudem muss nach der Verhältnismäßigkeit gefragt werden. Übersteigt der Ertrag die Kosten deutlich und vorhersagbar sicher? Ist der Ertrag real, so wie die Kosten und Mühen real sind? Oder sind die Anstrengungen wirklich, der Nutzen für einen selbst dagegen imaginär?
Kommen in einer hierarchischen Kultur die Beschwernisse, die von den unteren Schichten getragen werden, nicht nur den höheren Schichten zugute, sondern profitieren alle von einer ungleichen Lastenverteilung und einer nach Rängen gegliederten Gruppe von Menschen?
Oder sind alle besser dran, wenn alle annähend gleiche Lasten und Pflichten und auch annähernd gleiche Erträge und Genüsse haben? Die Frage ist hier die eines nach Rängen gegliederten oder eines egalitären Zusammenlebens der Menschen.
Möglicherweise sind Mischformen beider Ordnungen, Mischungen aus Hierarchie und aus Gleichheit, am stabilsten. Aber was wird wo gemischt und für wen?
Dadurch trifft der Verkäufer für den Käufer die Kaufentscheidung.
Das ist eine heikle Konstruktion. Andererseits ist es in der Medizin das hergebrachte Verfahren. Und es spricht von der Sache her Vieles dafür. Der Patient hat nicht die Informationen um sich zu helfen und zu entscheiden was er benötigt um gesund zu werden.
Aber dennoch, das Verfahren, dass der Verkäufer von Waren und Leistungen die Entscheidung darüber trifft, was gekauft wird, ist problematisch. Es besteht die Gefahr, dass die Entscheidung zu sehr von den kommerziellen Interessen des Arztes geleitet wird. Daraus folgt dann ein zu Viel an Behandlung. Im Angelsächsischen gibt es den Fachausdruck overtreatment.
Nehmen wir theoretisch ein entgegengesetztes Modell. Der Arzt oder auch die Klinik usw. bekommt feste Bezüge, vollkommen unabhängig von Volumen und Qualität der Behandlungen – Mindeststandards natürlich vorausgesetzt. Wenn das wirtschaftliche Interesse von der Menge der Behandlungen abgekoppelt ist, besteht keine Gefahr der Überbehandlung aus kommerziellen Erwägungen. Es ist bei diesem Modell eher zu befürchten, dass zu wenig und auf zu niedrigem Niveau behandelt wird. Ein wirtschaftlicher Wettbewerb um die Patienten entfällt. Der Anreiz besser zu sein als die Konkurrenz besteht nicht. Man hätte lediglich Mehrarbeit ohne Mehreinnahmen.
Gibt es ein Modell der Gesundheitsökonomie, das die Vorzüge beider Modelle vereint?
oben

weiter unten

THW

Warum das viele Leiden auf der Welt, ganz besonders mein eigenes? Aber selbst das Leiden entfernter, uns fremder Menschen berührt. Warum Krieg, Folter, Krankheit, Sterben …?
Hier ist die, in der Menschheitsgeschichte schon seit Jahrtausenden gesuchte, Antwort:
Leiden, und allgemein unangenehme Empfindungen, wie Schmerz, Trauer, Müdigkeit, Krankheitsgefühl, Angst …, sind hoch nützliche Erscheinungen der Seele.
Diese negativen Seelenphänomene sind in der Evolution entstanden, weil sie dazu führen, dass Lebewesen Zustände meiden, die eine negative Auswirkung auf ihre Überlebens- und Vermehrungsfähigkeit haben. Leiden bedingt, dass negative Faktoren für die evolutionäre Fitness vermieden werden und damit ist Leiden selbst ein positiver Faktor für das Gedeihen, für das Leben.
Somit ist Gott auch in der Frage des Leidens, der Schmerzen, der ganzen negativen Empfindungen gerechtfertigt. Diese negativen Empfindungen zeigen uns die Richtung zum Guten. Es ist sozusagen die entgegengesetzte Richtung.
Schmerz z.B. zeigt uns Einflüsse, die wir im Sinne unserer Fitness, im Sinne unserer Erhaltung und Fortpflanzung meiden sollten. Das gilt zumindest so häufig, dass Lebewesen, die Schmerz empfinden konnten und damit schädlichen Reizen ausgewichen sind, einen Selektionsvorteil hatten.
Allgemein gefasst dienen negative Empfindungen der evolutionsbiologischen Fitness. Sie zeigen den Lebewesen Dinge auf, die sie vermeiden sollten. Durch diese Vermeidung haben dann die Lebewesen, die zu diesen negativen Empfindungen fähig sind, einen Selektionsvorteil.
An Leprakranken, die an ihren Füßen keinen Schmerz mehr fühlen können, zeigt sich, wie gut es in vielen Fällen ist, wenn wir zur Schmerzempfindung fähig sind. Diese Leprakranken haben schreckliche Verletzungen und Infektionen an Körperteilen, wie den Füßen, an denen auch die negativen Empfindungen nicht mehr funktionieren.
Es ist somit in vielen Fällen gut, wenn wir leiden und überhaupt leiden können. Das Leiden kann uns dazu bringen, unsere Fitness zu erhöhen. Es kann uns einen Selektionsvorteil sichern. Leiden ist in diesem Sinne gut.
Es ist nicht gut im Sinne des eigentlich Guten. Das Gute wird als das zu Suchende, das Erstrebenswerte empfunden. In diesem direkten Sinn sind Leiden und Not dem Guten natürlich entgegengesetzt. Wir sind bestrebt, und sollten das auch sein, das Leiden wo möglich zu vermeiden. Leiden zeigt uns, wie schon bemerkt, die dem Guten entgegengesetzte Richtung und führt dadurch indirekt auch zum Guten. Leiden ist als Wegweiser zu seinem Gegenteil in der Tat gut und nützlich. Niemand würde den Nutzen und Sinn von Wegweisern bestreiten wollen.
Ein besonderer Fall ist, wenn, wie bei vielen nützlichen Anstrengungen, das Leiden für den Preis eines höheren Gutes in Kauf genommen wird. So ist es sinnvoll, wenn Kinder leiden, weil sie Hausaufgaben machen müssen, weil durch dieses meist geringe Leiden das Gut einer Erziehung und Bildung junger Menschen gewonnen wird. Dieses Gut steht um ein Vielfaches höher, als das Leiden an den Hausaufgaben. Und ich habe mir sagen lassen, und erinnere mich sogar entfernt aus meiner eigenen Schulzeit daran, dass ganz selten und äußerst “bisweilen” es vorkommen könnte, dass Kinder und auch Erwachsene ihre “unangenehmen” Pflichten gerne und mit Freude erfüllen.
Das ist aber ein anderes Thema, es ist das Thema des Preises für ein Gut, den wir zu “zahlen” bereit sind.
Wir haben in diesem Beitrag erklärt, warum die Existenz von Leiden, Schmerzen … in Einklang ist mit der Vorstellung von einem, wie mein Sohn treffend formuliert, “guten Gott”.
Für Kalorienreduktion gibt es mehrere Ernährungsstile z. B. die Okinawa-Diät oder die CRON-Diät (= Calorie Restriction Optimal Nutrition).
Hier sind meine Vorschläge zur Ernährung. Zunächst einige Grundprinzipien:
Nichts essen, was einem nicht schmeckt. Mein Bruder und ich hatten als Kinder einen sehr guten Pädiater, Dr. Rosenthal. Er sagte, wenn Kinder keinen verbildeten Appetit haben, wissen sie, was sie brauchen und was sie nicht brauchen. Diesen unverbildeten Appetit kann man auch bei Erwachsenen finden oder wieder finden.
Keine Diät-Produkte und allgemein keine Waren (Kalorienrechner …), die mit einem bestimmten Ernährungsstil verbunden sind.
Keine Kalorienzählerei und schon gar nicht einen Rechner mit spezieller Software in der Küche, der einem seine Mahrzeiten “ausrechnet”.
Essen Sie was ihnen schmeckt und steigen sie einmal in der Woche auf eine Waage. Dann wissen Sie schon, ob Sie ein bisschen weniger von dem essen sollte, was Ihnen schmeckt oder auch ein bisschen mehr.
So, jetzt etwas konkreter zu dem gesunden Essen:
Zunächst viel trinken.
Dann nichts oder nur wenig Gesüßtes und keine Zuckerersatzstoffe.
Viel frisches Obst und Gemüse.
Essen Sie regionale Lebensmittel und essen Sie saisonal. Die Sachen sind reif und frisch und lange Transportwege und -zeiten fallen weg.
Essen Sie ruhig traditionell. Traditionen sind gemeinschaftsstiftend und Traditionen sind oft klüger als man denkt. Sie haben einen langen Selektionsprozess überstanden, anders gewendet haben sie sich über einen langen Zeitraum angepasst und bewährt. Traditionen lassen sich nicht vollständig vernünftig begründen. Das müssen sie auch nicht, zumal uns eine vollständige Erklärung bei nichts gelingt. Vielmehr hat unsere Erkenntnis enge Grenzen und ein Hybris des Rationalismus führt in die Katastrophe. Das ist jedoch ein anderes Thema, zu dem Friedrich August von Hayek Bedeutendes geschrieben hat.
Wenn es Ihnen schmeckt, essen Sie Fleisch, allerdings nicht unbedingt jeden Tag, vielleicht jeden zweiten Tag oder auch nur einmal in der Woche.
Essen Sie Fisch …
Wenn es in Ihrer Kultur und Religion Fastentage und Fastenzeiten gibt, dann denken Sie darüber nach, ob Sie diese Fastenregeln nicht einhalten wollen.
Essen Sie nur so viel, dass Sie satt sind, nicht mehr. Lassen Sie gegebenenfalls ruhig “Anstandsreste” auf dem Teller übrig.
Wenn Sie doch einmal über die Stränge geschlagen haben, lassen Sie einfach die nächste Mahlzeit aus. Wenn Sie sich dabei wohl fühlen, können Sie Mahlzeiten auslassen. Das dürfte in der Evolution der Menschen häufiger gewesen sein, als regelmäßig drei bis fünf Mahlzeiten pro Tag.
Das war’s schon zum gesunden, kalorienreduzierten Essen mit guter Nährstoffzufuhr und ohne Gefahr von Mangelerscheinungen und Essstörungen, aber auch ohne die noch viel weiter verbreiteten gesundheitlichen Nachteil von Übergewicht und Fehlernährung.
die zwei seiten eines blattes, mann und

schiff

erster leiterwagen, sehr alt, modell wird schon lange nicht mehr gebaut:
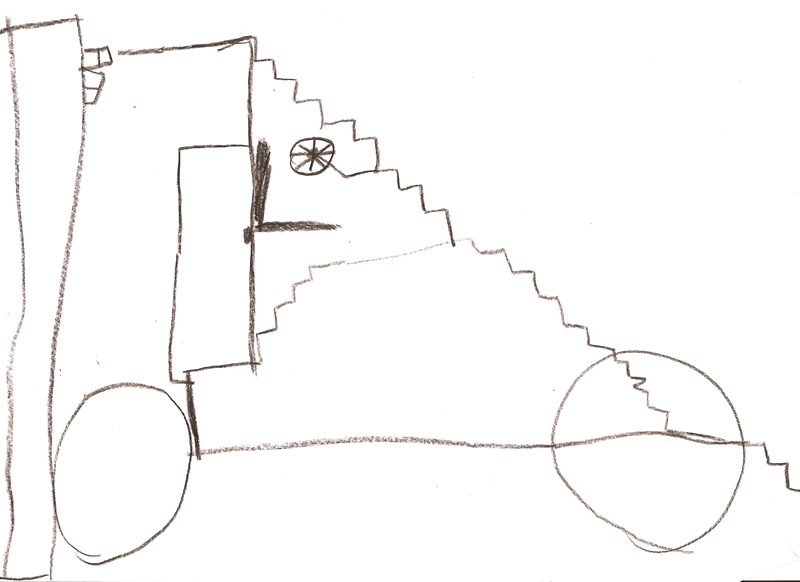
traktor typ 1:

Gibt es einen Gott oder auch mehrere Götter? Diese Frage ist alt. Antworten darauf gehen zum einen in die religiöse und theologische Richtung. Diese Antworten bejahen die Frage auf verschiedene Weise.
Die andere Richtung des Antwortens ist die agnostische oder atheistische Richtung. Hier wird festgestellt, dass wir über Gott und seine Existenz nichts wissen können (Agnostizismus) oder, das ist die atheistische Variante, dass wir mit hoher Sicherheit wissen, dass es Gott nicht gibt.
Russells chinesische Teekanne wird gerne zitiert um das agnostische Theorem zu entkräften und dem Atheismus das Wort zu reden.
Many orthodox people speak as though it were the business of sceptics to disprove received dogmas rather than of dogmatists to prove them. This is, of course, a mistake. If I were to suggest that between the Earth and Mars there is a china teapot revolving about the sun in an elliptical orbit, nobody would be able to disprove my assertion provided I were careful to add that the teapot is too small to be revealed even by our most powerful telescopes. But if I were to go on to say that, since my assertion cannot be disproved, it is intolerable presumption on the part of human reason to doubt it, I should rightly be thought to be talking nonsense. If, however, the existence of such a teapot were affirmed in ancient books, taught as the sacred truth every Sunday, and instilled into the minds of children at school, hesitation to believe in its existence would become a mark of eccentricity and entitle the doubter to the attentions of the psychiatrist in an enlightened age or of the Inquisitor in an earlier time.
[Bertrand Russell, „Is There a God?“ commissioned by, but never published in, Illustrated Magazine (1952: repr. The Collected Papers of Bertrand Russell, Volume 11: Last Philosophical Testament, 1943-68, ed. John G Slater and Peter Köllner (London: Routledge, 1997), pp. 543-48, quoted from S T Joshi, Atheism: A Reader]
Wir haben hier zum einen das Problem der Immunisierung einer Behauptung gegen ihre Widerlegung, gegen ihre Falsifikation (Popper). Anders gewendet ist die Behauptung, da nicht falsifizierbar, unwissenschaftlich.
Was interessanter erscheit, ist, dass die Antwort mit der Teekanne, wie auch die Frage ob Gott existiert, weit am eigentlichen Problem vorbeigehen.
Die Frage ob Gott existiert, so wie es eine Teekanne zwischen Erde und Mars gibt, macht Gott zur Sache. Diese Sache gibt es, oder auch nicht, oder mit Graden der Wahrscheinlichkeit gibt es sie nicht usw. … Und es werden mehr oder weniger schlaue Argumente in die eine oder andere Richtung ausgetauscht. Beide Richtungen sind falsch und auch Russell liegt weit daneben, ungefähr so weit wie die Erde vom Mars entfernt ist.
Die Richtung der Frage muss vielmehr auf die Bedingung von Existenz überhaupt zielen. Oder, in der Methapher der „Schöpfung“ gesprochen, ist es die Frage nach dem „Schöpfer“ von Allem und auch die Frage nach dem „Schöpfer“ von Existenz überhaupt.
Damit wäre auch die Antwort, dass die Bedingung u. a. von Existenz überhaupt selbst existiert, offenkundig zirkulär.
Die Rede, es gibt Gott, oder es gibt Gott nicht, oder wir können nicht wissen ob es Gott gibt oder nicht gibt, krankt an der Vorstellung Gott würde existieren. Dagegen sollte die Frage in die Richtung der Bedingung aller Existenz und allgemeiner in die Richtung der Bedingung von Allem überhaupt gestellt werden.
Wenn diese Richtung der Frage nach Gott verfehlt wird, kommen wir doch noch zu der Antwort, Gott sei eine chinesische Teekanne zwischen Erde und Mars.
Milton Friedman hat den Ausdruck geprägt: „There´s only two kinds of money – yours and mine.“ Es gibt zwei Arten von Geld: das Eigene und das der Anderen.
Bei staatlichen Ausgaben ist es nicht nur das Geld anderer Leute, sondern diese anderen Leute sind als Steuerzahler weitgehend anonym.
Wenn ein Prokurist das Geld seines Chefs ausgibt, weiß er wessen Geld das ist. Und in diesem Fall weiß der Chef auch genau, wer sein Geld ausgibt. Der Prokurist wird also sehr bedacht und verantwortungsbewusst verfahren.
Der Steuerzahler jedoch hat wenig Informationen über die staatlichen Geldflüsse, obwohl es sein Geld ist, das fließt, über dessen Fluss aber andere entscheiden.
Die Sanktionsmöglichkeiten bei Misswirtschaft sind noch geringer als die Informationsmöglichkeiten, die Rechnungshöfe sind zahnlose Papiertiger.
In der Evolutionstheorie spielte lange Zeit lediglich die Selektion von Individuen eine Rolle. Die Selektion und Fitness von Gruppen von Individuen wurde entweder bestritten oder als wenig bedeutend eingestuft.
Eine Schwierigkeit ist die Ausschließlichkeit mit der die Evolutionsbiologie die Vererbung an das Genom koppelt. (vgl. Video von W.D. Hamilton)
Andere Infomationsträger, wie die Meme, kulturell übertragen Informationen, sollen das Konzept ergänzen. Und es wird zunehmend gesehen, dass auf allen Ebenen, von der Nukleinsäure bis hin zu Galaxienhaufen, und möglicherweise sogar ganzen Universen, im Rahmen der Theorie multipler Universen, Selektion besteht. Auf allen Ebenen überleben die besser Angepassten und vermehren sich und die anderen Einheiten verschwinden, unterliegen, sterben aus …
Das gilt bei uns Menschen auch für Gruppen wie Familien, Dörfer, Stämme, Volksgruppen, Länder, supranationale Gemeinschaften und für die Menschheit insgesamt. Aber ebenso auch für Kunstrichtungen, Freundeskreise, Betriebe …
Leider wird aus verschiedenen Gründen, besonders aber weil der Weg der Informationsvererbung unklar scheint, die Evolution auf anderen Ebenen als dem Individuum zu wenig erforscht. Die multilevel selection theory steckt noch in ihren Kinderschuhen.
das tier:

tag

und nacht

Zum Kinderwahlrecht, von Geburt an, wurde am 27.6.08 ein Antrag an den deutschen Bundestag, Berlin, gestellt. Unterzeichnet ist der Antrag von 46 Abgeordneten aus CDU, CSU, SPD und FDP, darunter die frühere Familienministerin Renate Schmidt und Bundestags-Vizepräsident Wolfgang Thierse (beide SPD) sowie FDP-Generalsekretär Dirk Niebel, Renate Blank (CSU) und Michael Kretschmer (CDU).
Namhafte Unterstützer des Kinderwahlrechts sind u. a.
Wenn man die Entwicklung des Wahlrechtes in Demokratien anschaut, ist das Wahlrecht für Kinder, treuhänderisch von den Eltern ausgeübt, folgerichtig.
Am Anfang hatten in den jungen Demokratien Englands oder Deutschlands nur die wohlhabenden, männlichen Bürger das Wahlrecht. So gab es in Preußen von 1849 bis 1918 ein „Dreiklassenwahlrecht“. Dabei wurde die Stimme des Wahlberechtigten männlichen Bürgers nach seinem Steueraufkommen gewichtet.
Die Gleichgewichtung der Stimmen und das Frauenwahlrecht wurden in Deutschland erst 1918 eingeführt. In der Schweiz kam das Frauenwahlrecht erst 1971. Die Schweiz ist das einzige Land, in dem die Männer den Frauen das Wahlrecht in einer Abstimmung erteilt haben.
Die Altersgrenze des Wahlrechts sinkt auch tendenziell. In Preußen waren die jungen Jahrgänge noch stark vertreten, sodaß bei Ausschluss aller Frauen und aller unter 25-Jährigen 1871 knapp 20% des deutschen Volkes ein Wahlrecht hatte.
In der Bundesrepublik Deutschland wurde 1971 die Altersgrenze des Wahlrechts von 21 auf 18 Jahre gesenkt. 1995 wurde in Nidersachsen das Wahlalter für Kommunalwahlen auf 16 Jahre gesenkt. Weitere Bundesländer folgten.
Heute ist durch die niedrigen Geburtenraten der Anteil von Kindern und Jugendlichen an der Bevölkerung dramatisch gesunken. Gleichzeitig steigen die Lasten, die diesen Kindern und jungen Menschen von den Entscheidungsträgern aufgebürdet und zugemutet werden.
Diese Belastungen durch Renten- und Sozialversicherungen und durch eine ungeheuerliche Staatsverschuldung soll auf immer weniger Schultern verteilt werden.
Hier ist es geboten, dass die kommenden Generationen schon jetzt durch das Wahlrecht Einfluss haben. Das Wahlrecht kann treuhänderisch von den Eltern ausgeübt werden.
Das verfassungsrechtliche Argument des Antrags an den deutschen Bundestag vom 27.6.08 ist die Volkssouveränität Artikel 20 Abs. 2 GG:
„(2) Alle Staatsgewalt geht vom Volke aus. Sie wird vom Volke in Wahlen und Abstimmungen und durch besondere Organe der Gesetzgebung, der vollziehenden Gewalt und der Rechtsprechung ausgeübt.“ (Hervorhebung K.K.)
Natürlich gibt es bei der Volkszugehörigkeit keine Altersbeschränkung. Auch Kinder und Jugendliche gehören zum Volk und üben nach dem Wortlaut des Art. 20 GG ihre Souveränität in Wahlen aus.
Dem steht der Artikel 38 Abs. 2 erster Halbsatz GG entgegen:
„(2) Wahlberechtigt ist, wer das achtzehnte Lebensjahr vollendet hat;“
Dieser Halbsatz soll nach dem Vorschlag der 46 Abgeordneten ersatzlos gestrichen werden.
Der Antrag favorisiert die treuhänderische Ausübung des Wahlrechtes durch die Eltern. Er setzt sich umsichtig mit den Argumenten gegen das Kinderwahlrecht auseinander und widerlegt diese, wie ich meine, überzeugend.
In welcher Reihenfolge wurden die Kleider und Waffen angelegt?
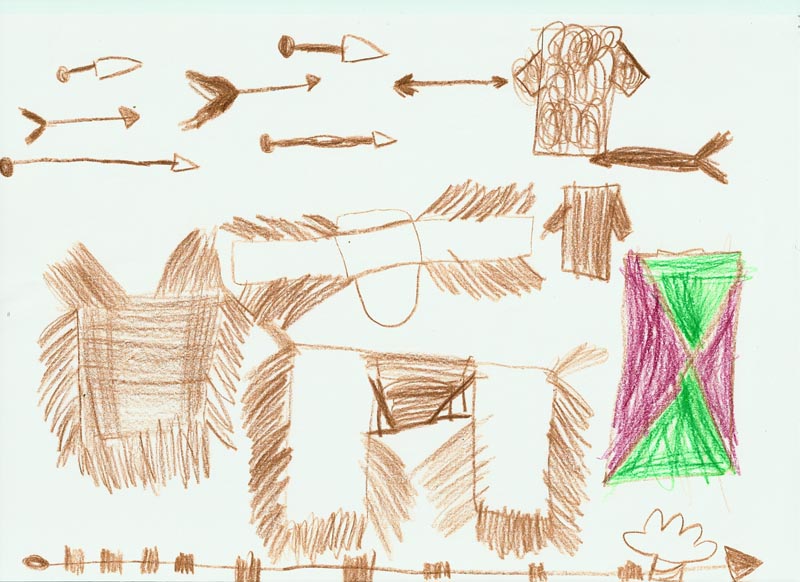
Ikarus flog zu nah an die Sonne heran.
Unsere modernen Raketen starten bereits auf Augenhöhe mit ihr.

Die Geburtenrate in fast allen Industrieländern ist viel zu niedrig. In Deutschland liegt sie bei unter 1,4 Kindern pro Frau.
Verschiedene gesellschaftliche und politische Maßnahmen werden diskutiert.
Grundlegender als Einzelmaßnahmen erscheint mir, dass Kinder, und damit auch Familien mit Kindern, mehr politisches Gewicht bekommen.
Das ist in einer Demokratie durch ein Wahlrecht für Kinder möglich. Die Ausübung erfolgt bis zur Volljährigkeit treuhänderisch durch die Erziehungsberechtigten.
Fraktionenübergreifend wurde 2004 von 46 Abgeordneten ein Antrag in den Bundestag eingebracht. Die Initiative wird auch von Ex-Bundespräsident Roman Herzog unterstützt.
Pro Argumente sind:

“Als Henoch 65 Jahre alt war, zeugte er den Methusalah … Als Methusalah 187 Jahre alt war, zeugte er den Lamech. Und nachdem Methusalah den Lamech gezeugt, lebte er noch 782 Jahre und zeugte Söhne und Töchter. So betrug Methusalahs ganze Lebenszeit 969 Jahre; dann starb er.“ (1. Mose 5:21ff.)
Aubrey de Grey glaubt, dass ein biblisches Alter von an die 1000 Jahren heute technologisch in den Bereich der Machbarkeit rückt. Ob das dann wirklich im Laufe der nächsten 30 Jahre gelingt, ob Audrey de Grey eher science fiction als science hervorbringt, sei dahingestellt.
Eine gewisse Bedeutung haben Aubrey de Grey und die Methuselah Foundation bereits gewonnen. Das wissenschaftliche Organ der Foundation hat, nach eigenen Angaben, einen beachtlichen Impact Factor von 8.353.
Der wesentliche Einwand gegen das Projekt ist der Selektionsvorteil, den Lebewesen durch sexuelle Fortpflanzung und den Tod der Elterngeneration haben. Dieser Selektionsvorteil würde durch eine längere Lebensspanne und eine niedrigere Reproduktionsrate deutlich schwächer.
Mit der sexuellen Fortpflanzung haben Lebewesen, im Unterschied zu asexuellen Formen, wie der Zellteilung bei Einzellern, den Vorteil, dass das Erbgut der Eltern auf verschiedene Weise neu kombiniert wird. Diese Möglichkeit der Rekombination und der besseren Anpassung und „Höherentwicklung“ von Generation zu Generation ist bei einem Generationszyclus von ca. 30 Jahren bedeutend größer, als bei längeren Generationszyclen von beispielsweise 300 oder 600 Jahren.
Das lässt eine normale Lebensspanne und einen normalen Generationszyklus, gegenüber einem „biblischen Alter“, als vorteilhaft erscheinen, .
Die evolutiosbiologischen Vorteile von sexueller Fortpflanzung, Generationsfolge, Altern und Tod sind auch die lange von der Theologie gesuchte Rechtfertigung Gottes.
Gott wäre bezüglich Altern und Tod entschuldigt. Die Theodizee wäre in diesem Bereich gelungen. Das Paradies wäre hier, in diesem Punkt, wiedergefunden.
_________
Ein Bezug auf Religiöses ermöglicht es Gedanken, Wünsche, Träume aufzugreifen, die eine lange Tradition haben und die Menschen beschäftigen. Zudem ist die Form religiöser Themen oft kunstvoll und über Generationen verfeinert und geschliffen.
Einhörner sind seltene Tiere. Aber manchmal kann man sie doch sehen:
Klavierspielen muss den Kindern Spaß machen. Man kann die Kleinen doch nicht zu einem Instrument zwingen. Kindergarten, Schule, Sport, Freizeit, alles soll unseren Kindern Spaß machen.
Ich denke das ist vollkommen falsch. Kinder und Erwachsene sollten das tun, was richtig ist. Unabhängig davon, ob es gerade Spaß macht oder nicht. Ja gerade die, besonders anfängliche, Überwindung von Widerständen, die Überwindung von Trägheit und Unlust sind in der Erziehung und auch für die Selbstdisziplin das entscheidende Moment. Und wenn dann eine Aufgabe trotz Unlust und Unwillen, trotz anderer Widrigkeiten gemeistert wurde, entsteht Glück. Es ist das Glück auf dem Gipfel eines Berges nach dem beschwerlichen und mühsamen Aufstieg. Es ist die wirkliche Zufriedenheit nach getaner Arbeit.
Jedoch, wenn alles immer Spaß machen muss, dann kann man weder innere noch äußere Widerstände überwinden, dann wird man keine größeren Erfolge erreichen können, denn die kosten Schweiß und Mühen. Man wird sich lediglich im Seichten, Gewohnten und Bequemen aufhalten. Und man wird mit dieser schlappen Spaß-Einstellung letztlich, und hier liegt ein Paradox, weniger Spaß haben, als wenn man lernt, seine Pflicht zu tun, ganz unabhängig davon, ob es Spaß macht oder nicht.
Religionen sind möglicherweise einer wissenschaftlichen Weltanschauung in dem entscheidenden Punkt überlegen.
Es mag sein, dass der wissenschaftliche Wahrheitsbegriff besser ist. Es mag sein, dass die wissenschaftlichen Methoden einen rascheren Fortschritt in Medizin, Technik, Weltverständnis usw. bringen.
Wenn aber, und das ist der springende Punkt, in den hoch industrialisierten, wissenschaftlich geprägten Ländern die Geburtenraten zu niedrig sind, werden die wissenschaftlich geprägten Kulturen ganz einfach aussterben.
Wenn demgegenüber in stark religiös geprägten Kulturen die Geburtenraten hoch sind, oder zumindest ausreichend, dann werden diese Kulturen bestand haben und sich gegenüber den wissenschaftlich-technisch geprägten Kulturen behaupten.
Zuletzt überleben möglicherweise die streng religiösen Kulturen. Die starke und dauerhafte Verbreitung von Religionen spricht auch evolutionstheoretisch für diese Vermutung.
In der Evolutionstheorie, die selbst wieder dem wissenschaftlichen Geist entsprigt, ist nicht unbedingt die wisssenschaftliche Wahrheit entscheidend. Für den Erfolg, den Erhalt einer Population, kann bedeutsam sein, was andere als Aberglaube und Unwahrheit auffassen.
So kann eine Illusion, aus wissenschaftlicher Sicht, der wissenschaftlichen Anschauung überlegen sein, wenn die Illusion eher zur Reproduktion und damit zum Bestand und zur Ausbreitung einer Bevölkerungsgruppe führt.
Wissenschaftlich gesehen haben strenge Religionen aufgrund der besseren Familienstruktur und der höheren Geburtenraten den entscheidenden Vorteil gegenüber wissenschaftlich-industriellen Weltanschauungen.
Hier schreibt die wissenschaftliche antireligiöse Welt möglicherweise ihren eigenen Totenschein.
Wenn Religionskritiker, wie Dawkins, auf diesen Punkt nicht eingehen, übersehen sie das Grundlegende. Gerade in der Evolutionstheorie zählt nicht die Wahrheit oder wer jetzt mit seinen Anschauungen Recht hat. In der Evolutionstheorie ist die entscheidende Frage: wer überlebt, wer pflanzt sich erfolgreich fort. Es ist nicht die Frage, wer im Besitz einer wie auch immer gearteten überlegenen Wahrheit ist. Entscheidendend auf lange Sicht ist, wer die meisten Nachkommen hat.
„Seid fruchtbar und mehret euch.“
Die Techniker-Krankenkasse gibt eine Studie bekannt, nach der in Deutschland 800.000 Menschen zwanghaft und ohne wirklichen Bedarf kaufen. Sieben Prozent der Bevölkerung seien gefährdet. Der Psychologe Gerhard Raab, Ludwigshafen, habe die Sache untersucht.
Tatsächlich ist Gerhard Raab Hochschullehrer für Marketing und „internationales Marketing Management“ an der Fachhochschule Ludwigshafen. Er beschäftigt sich damit, wie man Produkte an die Kunden verkauft, im Grunde genommen auch mit der Frage, wie man Konsumenten süchtig macht. Der Experte kommt, und das muss gar nicht unbedingt ein Nachteil sein, nicht aus der konsumkritischen Ecke, sondern aus dem Bereich, der den Absatz und Konsum fördern soll.
Von der Drogensucht profitieren Produzenten und Händler. Bei der Kaufsucht ist es ebenso. Produzenten und Händler profitieren von dieser Krankheit. Ihre Gewinne steigen durch Kaufsüchtige. Werbung hat kein anderes Ziel, als den Absatz zu steigern. Und Werbung ist allgegenwärtig. Sie überschwemmt uns mit Reizen, sie schreit uns an, sie sticht in die Augen, sie überflutet die potentiellen Kunden. Leisen Töne, das Unaufdringliche scheinen ihr unbekannt. Ein wirkliches Interesse daran, was der Kunde braucht und was er nicht braucht, ist ihr fremd.
Und wo ist die Grenze zwischen „gerne Einkaufen“ und süchtig sein nach Shopping? Es ist doch das Ziel von Werbung, von Handel und Dienstleistung die Konsumenten süchtig nach den eigenen Produkten und Leistungen zu machen.
Der Verkauf soll zwischenmenschliche Bedürfnisse nach Zuwendung und Nähe befriedigen. Die Waren sollen Schönheit, sozialen Status usw. herstellen.
Natürlich erfüllt der Verkauf das Bedürfnis nach Menschlichkeit nicht. Und Waren machen nicht wirklich schöner. Ein Auto bestimmt nicht wirklich den sozialen Rang. Ein Hochstapler kann eine Luxuskarosse fahren und ein sehr vermögender Mensch oder eine wissenschaftliche Autorität können mit dem Fahrad daherkommen.
So ist es mit den anderen gekauften Dingen. Kleider machen bestenfalls so lange schöner, wie man sie trägt. Sind die Hüllen gefallen, zeigt sich die wirkliche Schönheit, oder auch deren Fehlen.
Was ist zu tun?
Enttarnen des Ersatzcharkters von Konsum. Marketing und Werbung versuchen die Bereiche zu vermischen und Konsum als Befriedigung verschiedener, starker Bedürfnisse erscheinen zu lassen. Aber in Wirklichkeit ist Konsum definitiv nicht:
Neben der Enttarnung und der Aufklärung über den Ersatzcharakter des Konsums, muss die Augenmerk auf die wirklich sinnvollen Handlungen gelenkt werden.
Menschlichkeit ist in der Familie, bei Freunden und Bekannten, bei allen Kontakten in der jeweils angemessenen Form möglich. Wird dabei etwas verkauft oder gekauft, verdirbt es das Verhältnis ein wenig, weil offenkundig ein wirtschaftliches Interesse im Hintergrund steht und Menschliches möglicherweise nur als Instrument für gute Geschäfte missbraucht wird. Umgekehrt sollte man geschäftliche Beziehungen sachlich, korrekt, freundlich und vor allem mit Anstand pflegen.
Auch wenn die Werbung den Konsum in den Vordergrund drängt, sollten andere Bereiche betont werden. Wichtiger sind
Ich habe zuerst durch eines der TED-Talk Videos etwas über calorie restriction erfahren. Dann die üblichen Schnell-Recherchen mit Google, Wikipedia … Dann PubMed als medizinische Datenbank und noch einzelne Studien über ScienceDirect.
Es wurde klar, an der Sache ist etwas dran. Vermutlich bei Weitem nicht so viel, wie einer der Protagonisten der calorie restriction, Roy L. Walford, angab. Walford sprach von einer Verdoppelung der aktiven Lebenspanne und einem Ernährungsstil, der eine Lebenserwartung von 120 Jahren ermöglichen sollte.
Ich denke man wurde, nachdem Walford mit 79 Jahren unglücklicherweise gestorben ist und noch mehr Studien zum Thema vorlagen, nüchterner.
Dennoch, die Tierversuche sind gut reproduzierbar. Bei allen Tierarten, mit Ausnahme der Stubenfliege, funktioniert eine Kalorienreduktion zur Verbesserung der Gesundheit und zur Verlängerung der durchschnittlichen und maximalen Lebenserwartung.
Randomisierte, kontrollierte Studien bei Menschen sind vielversprechend. Die Stoffwechselveränderungen entsprechen denen in Tierversuchen.
Wenn das Ganze auch nur in bescheidenen Maßen gelingt, wäre es ein enormer Durchbruch.
Die Kosten der Kalorienreduktion bei Menschen wären verschwindend. Um eine vollwertige und kalorienreduzierte Ernährung zu erreichen, muss man kaum mehr Geld ausgeben, wird andererseits auch bei den Lebensmittelkosten kaum etwas sparen können, denn was an Quantität gestrichen wird, kann bei der Qualität wiederum hinzugefügt werden. Es werden wohl weniger, aber höherwertige Lebensmittel verbraucht.
Die Krankheitskosten, die wegfallen, könnten allerdings enorm sein. Allein die Kosten durch Übergewicht und dessen Folgen würden eingespart. Dann käme noch die Steigerung der Gesundheit und die Verlängerung der aktiven Lebensspanne hinzu. Das wäre möglich bei einer Kalorienreduzierung von 10% bis ca. 30% unter den Normalbedarf bei Zufuhr aller notwendigen Nährstoffe und unter Vermeidung von Essstörungen und Mangelernährung.
Der gesundheitliche Nutzen für den Einzelnen und die etwaige Verlängerung der Lebensspanne wären unschätzbar. Der mögliche Gewinn für die Volkswirtschaft könnte enorm sein.